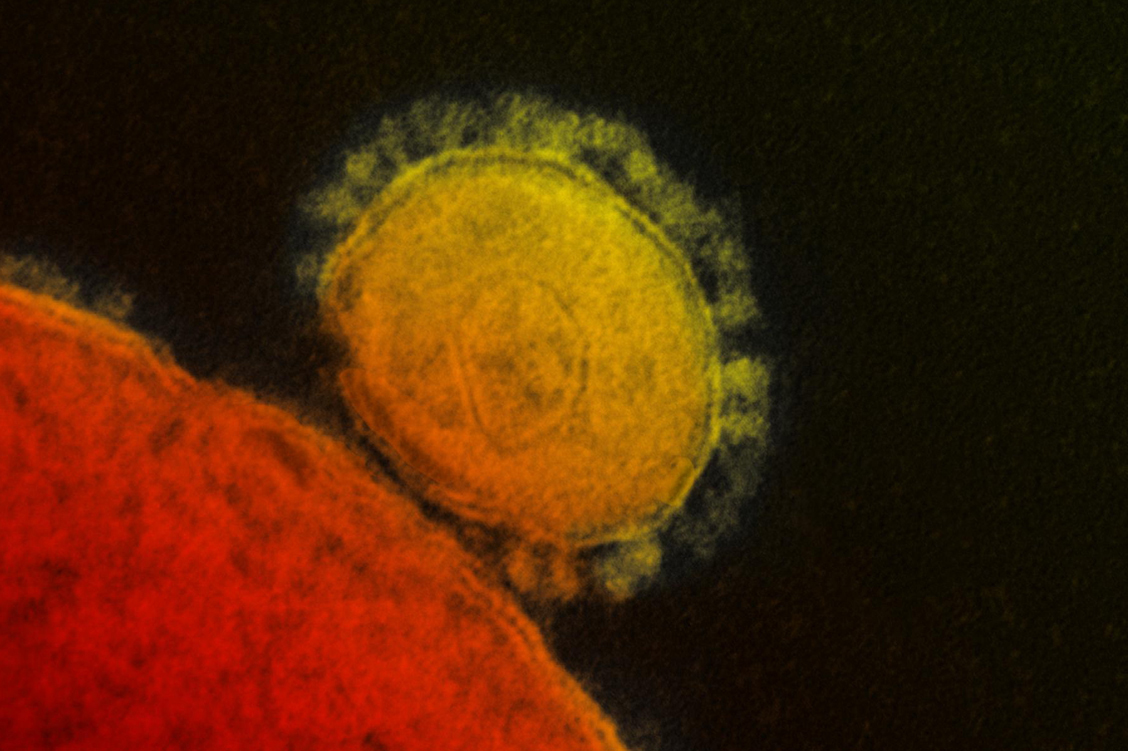Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sah auch am Donnerstagabend keinen Grund, eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite auszurufen. »Es ist nicht der richtige Zeitpunkt«, sagte der Vorsitzende des Notfallsausschusses, Didier Houssin. Er verwies darauf, dass es im Ausland bislang nur wenig Fälle gebe, und dass China bereits selbst weitreichende Vorkehrungen getroffen habe. WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, China habe diejenigen Maßnahmen getroffen, die es für angemessen halte. »Wir hoffen, dass sie effektiv und von kurzer Dauer sind.« Die WHO empfehle keinerlei Reise- oder Handelsbeschränkungen. Die WHO nehme den Ausbruch aber extrem ernst, sagte WHO-Chef Tedros. »Es ist noch keine Notlage von internationaler Tragweite, aber das kann es noch werden.«