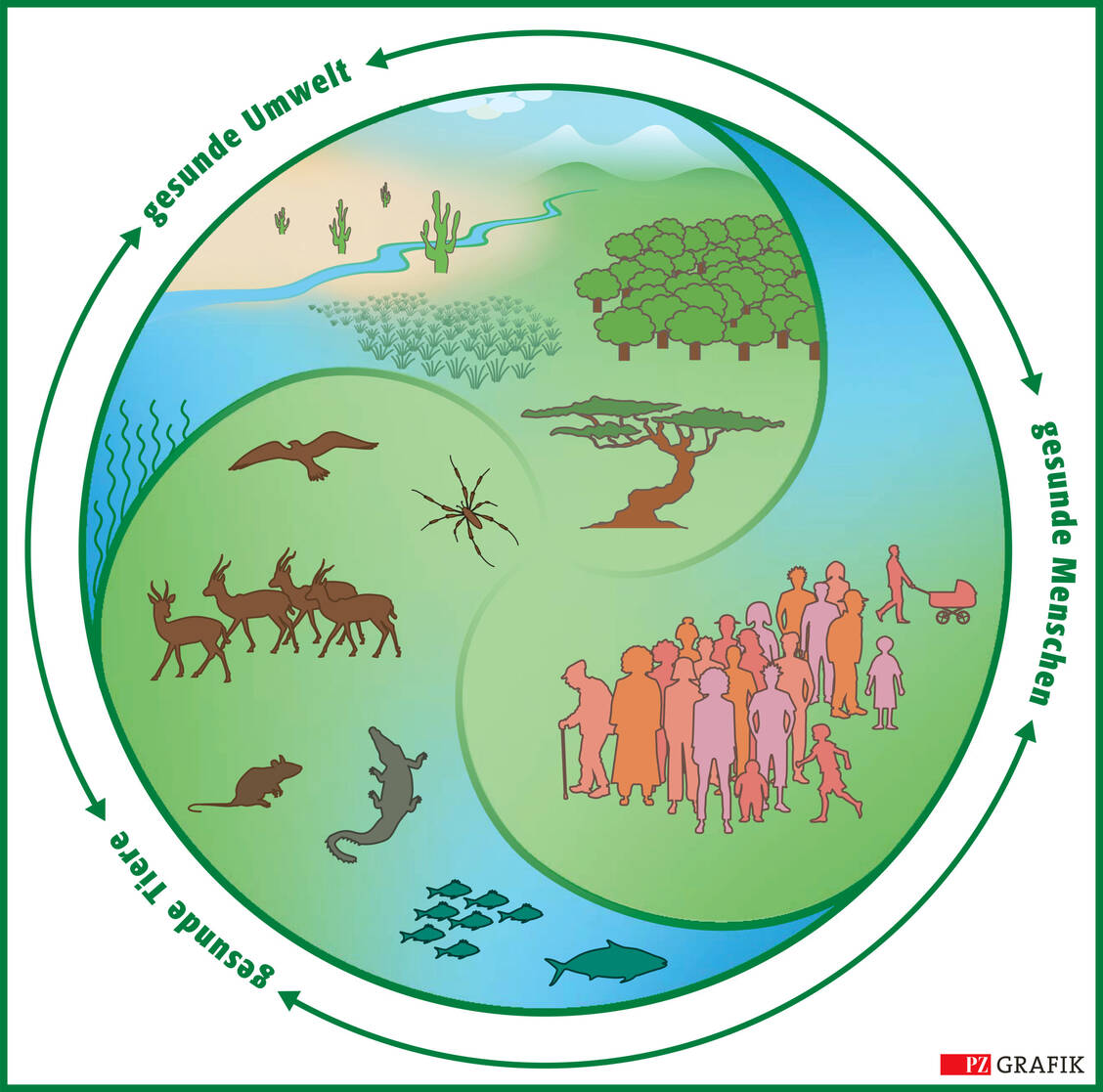Thomas C. Mettenleiter studierte von 1977 bis 1982 Biologie in Tübingen. Er promovierte 1985 in Genetik und habilitierte sich 2000 für Virologie. 1982 nahm er am Friedrich-Loeffler-Institut, vormals Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, erst in Tübingen, dann auf der Insel Riems bei Greifswald, seine Forschung auf. Von 1994 bis 2020 war er Leiter des Fachinstituts für molekulare Virologie und Zellbiologie sowie von Juli 1996 bis Juni 2023 Präsident dieser selbstständigen Bundesoberbehörde. Seit 2021 ist er Co-Vorsitzender des One Health High-Level Expert Panels von WHO, FAO, WOAH und UNEP. Sein Herz gehört der experimentellen Virusforschung auf molekularer Ebene.
Dana A. Thal studierte Ernährungswissenschaften in Potsdam, wobei sie insbesondere von den molekularbiologischen Abläufen in Zellen fasziniert war. 2018 folgte eine interdisziplinär angelegte Promotion am Institut für Biochemie der Universität Greifswald. 2019 trat sie eine Stelle als wissenschaftliche Referentin am Friedrich-Loeffler-Institut an und arbeitet dort als Geschäftsführerin der Nationalen Forschungsplattform für Zoonosen. Im Zuge dieser Tätigkeit engagiert sie sich für interdisziplinäre Forschung im Sinne des One-Health-Ansatzes und ist beteiligt an der Umsetzung einer One-Health-Forschungsplattform in Deutschland.