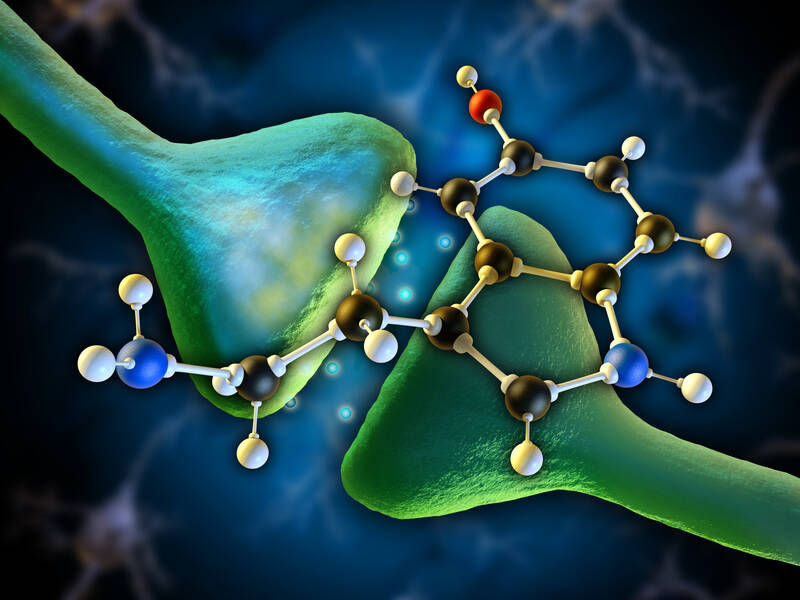|
Wirkstoffgruppe
|
Wirkstoffbeispiele
|
Wichtige Nebenwirkungen
|
|
SSRI: Selektive Serotonin-Rückaufnahme-Inhibitoren
|
Citalopram,Escitalopram,Fluoxetin,Fluvoxamin,Paroxetin,Sertralin
|
Schlafstörungen, Unruhe, gastrointestinale Störungen, erhöhte Blutungsneigung, Hyponatriämie, QT-Zeit-Verlängerung (bei einigen Substanzen), sexuelle Dysfunktion, Schwitzen
|
|
SSNRI: Selektive Serotonin-Noradrenalin-Rückaufnahme-Inhibitoren
|
Venlafaxin,Duloxetin,Milnacipran
|
Schlafstörungen, Unruhe, gastrointestinale Störungen, erhöhte Blutungsneigung, Hyponatriämie, QT-Zeit-Verlängerung (bei einigen Substanzen), sexuelle Dysfunktion, Schwitzen, Hypertonie
|
|
α2-Rezeptor-Antagonisten
|
Mirtazapin,Mianserin
|
Sedierung, Appetit- und Gewichtszunahme, Orthostase, Schwindel
|
|
TZA: Trizyklische Antidepressiva
|
Amitriptylin,Clomipramin,Doxepin,Imipramin,Nortriptylin,Trimipramin
|
Anticholinerge Effekte (Mundtrockenheit, Tachykardie, Akkomodationsstörungen, Delir), Sedierung, Appetit- und Gewichtszunahme, kardiale Überleitungsstörungen/ Herzrhythmusstörungen
|
|
MAO-Hemmer: Monoaminooxidase-Inhibitoren
|
Moclobemid,Tranylcypromin
|
Schlafstörungen, Mundtrockenheit, Orthostase, Tranylcypromin: hypertensive Krisen
|
|
Andere
|
|
|
|
|
Trazodon
|
Müdigkeit, orthostatische Dysregulation
|
|
|
Tianeptin
|
Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Missbrauchs- und Abhängigkeitspotenzial
|
|
|
Bupropion
|
Schlafstörungen, Unruhe, Hypertonie, Mundtrockenheit, Appetitlosigkeit, Tremor, Herabsetzung der Krampfschwelle (Cave: Epileptiker)
|
|
|
Agomelatin
|
Leberfunktionsstörungen, Sedierung
|
|
|
Lithiumsalze
|
Kognitive Störungen, Polyurie, Polydipsie, TSH-Anstieg, Strumabildung, Nierenfunktionsstörung, Ödembildung, Lithium-Akne
|
|
|
Esketamin
|
Schwindel, Sehstörungen, Tachykardie, Hypertonie, Übelkeit, gastrointestinale Beschwerden, Kopfschmerzen
|