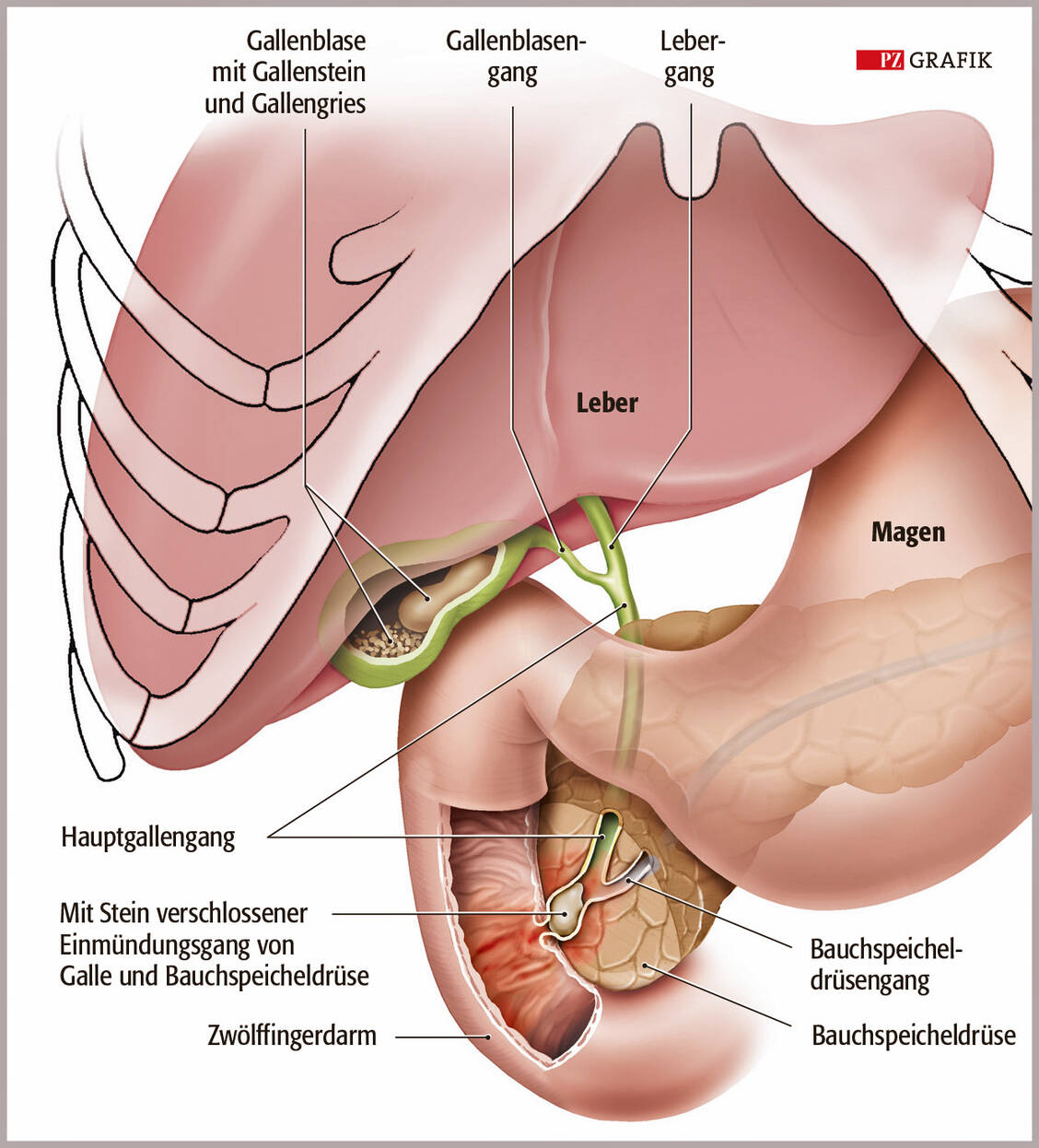Die chronische Cholezystitis ist eigentlich immer die Folge einer Cholelithiasis und zeigt rezidivierend die Symptome einer akuten Entzündung, die jedoch wieder zurückgeht. Die Gallenblase ist aber dauerhaft mechanisch gereizt und das birgt das Risiko einer Porzellangallenblase und eines Gallenblasenkarzinoms (3, 4). Patienten beschreiben oft ein andauerndes Druckgefühl im Oberbauch.
Die Diagnose wird bei der körperlichen Untersuchung durch das sogenannte »Murphy-Zeichen« gestellt. Dabei wird unterhalb des rechten Rippenbogens Druck ausgeübt, während der Patient einatmet. Wenn der Patient dabei einen heftigen Druckschmerz verspürt und nicht weiter tief einatmen kann, ist das Murphy-Zeichen positiv. Es hat eine Sensitivität von circa 60 Prozent und eine Spezifität von 80 bis 95 Prozent (1). Mit diversen Blutparametern, dem Murphy-Zeichen und einer Sonografie, die eine Wandverdickung, gegebenenfalls mit Ödembildung, zeigt, lässt sich die Cholezystitis (akut wie chronisch) sicher und schnell diagnostizieren.