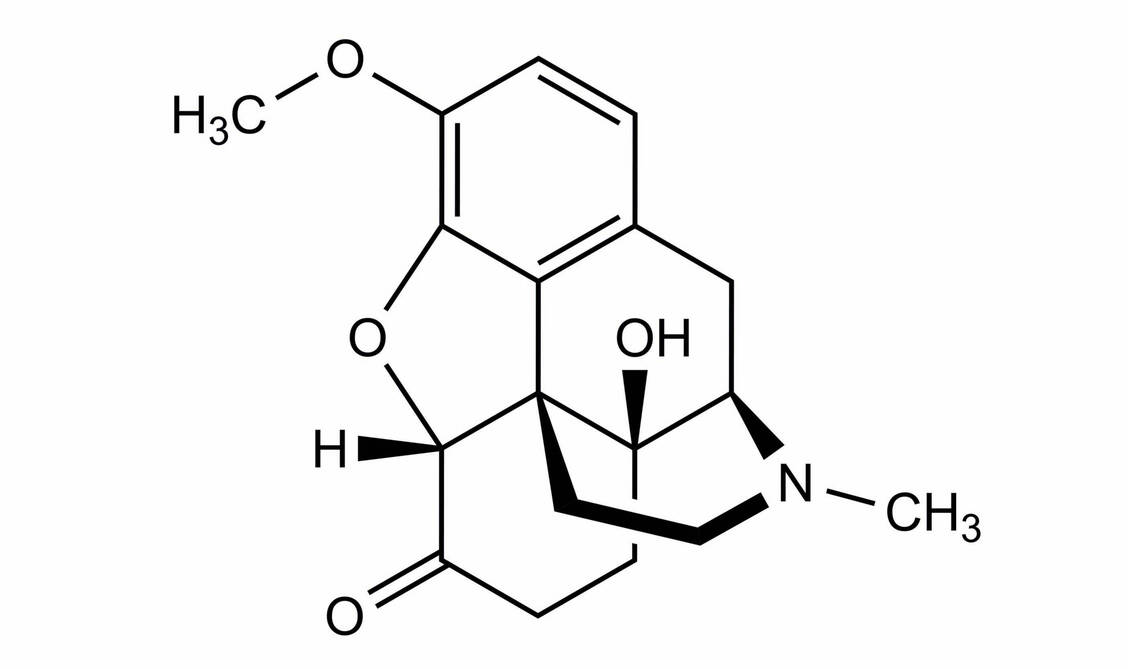Wird Oxycodon zusammen mit weiteren zentral dämpfenden Arzneimitteln wie andere Opioide, Beruhigungsmittel einschließlich Benzodiazepine, Muskelrelaxanzien, Antidepressiva, Neuroleptika, ZNS-gängige Antihistamika, Antiemetika sowie Alkohol angewendet, verstärken sich die sedierenden Effekte.
Bei gleichzeitiger Anwendung mit Arzneimitteln, die den Serotoninspiegel erhöhen, steigt das Risiko für das serotonerge Syndrom (Schwitzen, Fieber, Durchfall, Krampfanfälle, Verwirrtheit), darunter selektive Serotonin- und Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI, SNRI). Auch die gleichzeitige oder weniger als 14 Tage zurückliegende Einnahme von MAO-Hemmern wie Selegilin erhöht das serotonerge Risiko und kann zudem die Kreislauf- und Atemfunktion beeinträchtigen.
Anticholinergika wie Biperiden gegen Parkinson oder Glycopyrronium bei chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) können anticholinerge Nebenwirkungen von Oxycodon wie Mundtrockenheit verstärken.
Bei gleichzeitiger Gabe mit Cumarinderivaten kann es zu einer verzögerten oder auch beschleunigten Blutgerinnung kommen.
CYP3A4-Inhibitoren wie Makrolid-Antibiotika (etwa Clarithromycin oder Erythromycin), Azol-Antimykotika und Proteasehemmer (etwa Ritonavir) sowie Cimetidin und Grapefruitsaft können die Wirkspiegel von Oxycodon erhöhen. Selbiges gilt in geringerem Maße für Hemmstoffe von CYP2D6 wie Paroxetin, Fluoxetin und Chinidin. CYP3A4-Induktoren wie Rifampicin, Carbamazepin, Phenytoin und Johanniskraut beschleunigen dagegen den Abbau von Oxycodon und machen möglicherweise eine Dosiserhöhung nötig.