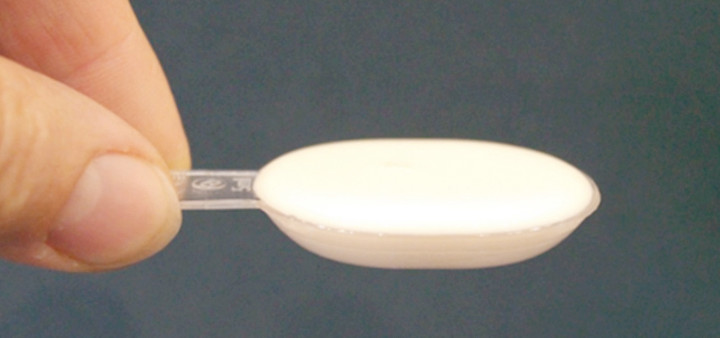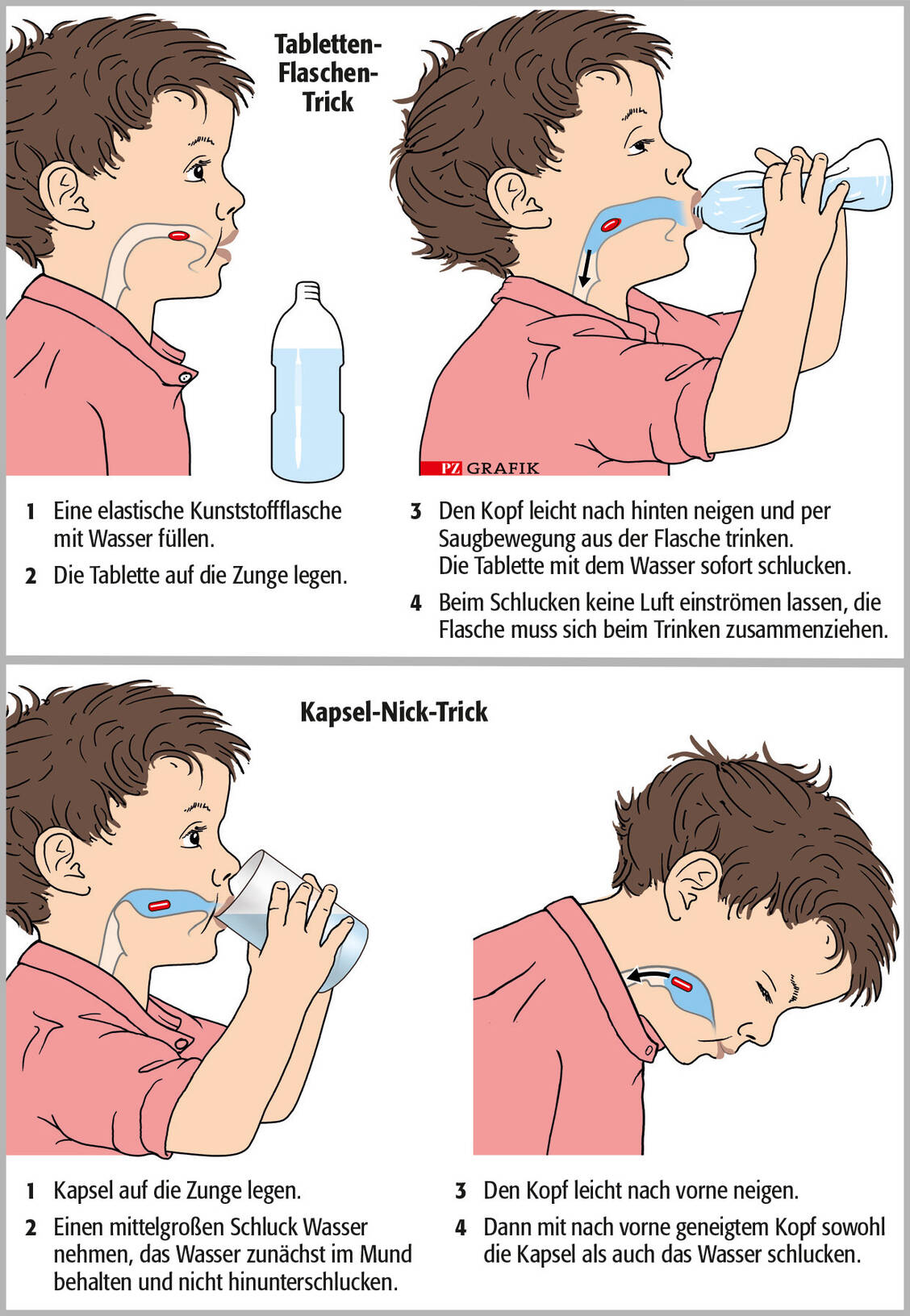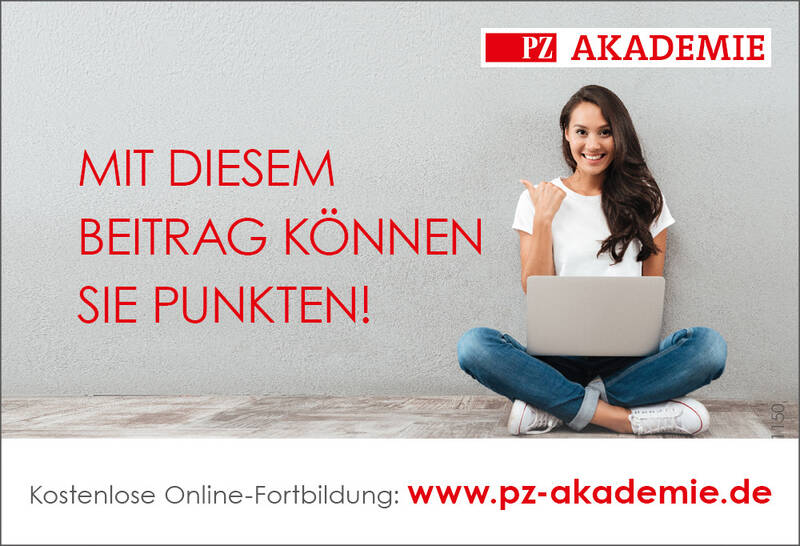Insgesamt sind für Kinder möglichst kleine, überzogene, runde Arzneiformen leichter einzunehmen und sollten zum Beispiel bei der Auswahl aus mehreren Rabattarzneimitteln bevorzugt werden. Ist trotz aller Tricks und Tipps eine Einnahme nicht möglich, stellt sich die Frage des Zerkleinerns oder Mörserns. Hilfreiche Informationsquellen sind hier neben Fachinformationen die Informationen des ABDATA-Plus-X-Moduls und die durch die Universität Erlangen erstellte Online-Datenbank »Kinderformularium« (4).
Eine weitere Hilfestellung, um den Geschmack zerkleinerter Tabletten zu maskieren, bietet ein Reflexionspapier der Europäischen Arzneimittelagentur EMA aus dem Jahr 2005 (5). Hier sind verschiedene Geschmacksrichtungen vorgeschlagen, die den Geschmack eines Medikaments überdecken sollen. Bitterer Geschmack lässt sich demnach beispielsweise mit den Geschmacksrichtungen Kirsche, Schokolade, Grapefruit, Lakritz, Erdbeere, Pfirsich oder Himbeere maskieren. Manchmal reicht es auch aus, ein Arzneimittel möglichst kühl zu verabreichen; ein unangenehmer Geschmack wird so weniger stark wahrgenommen.