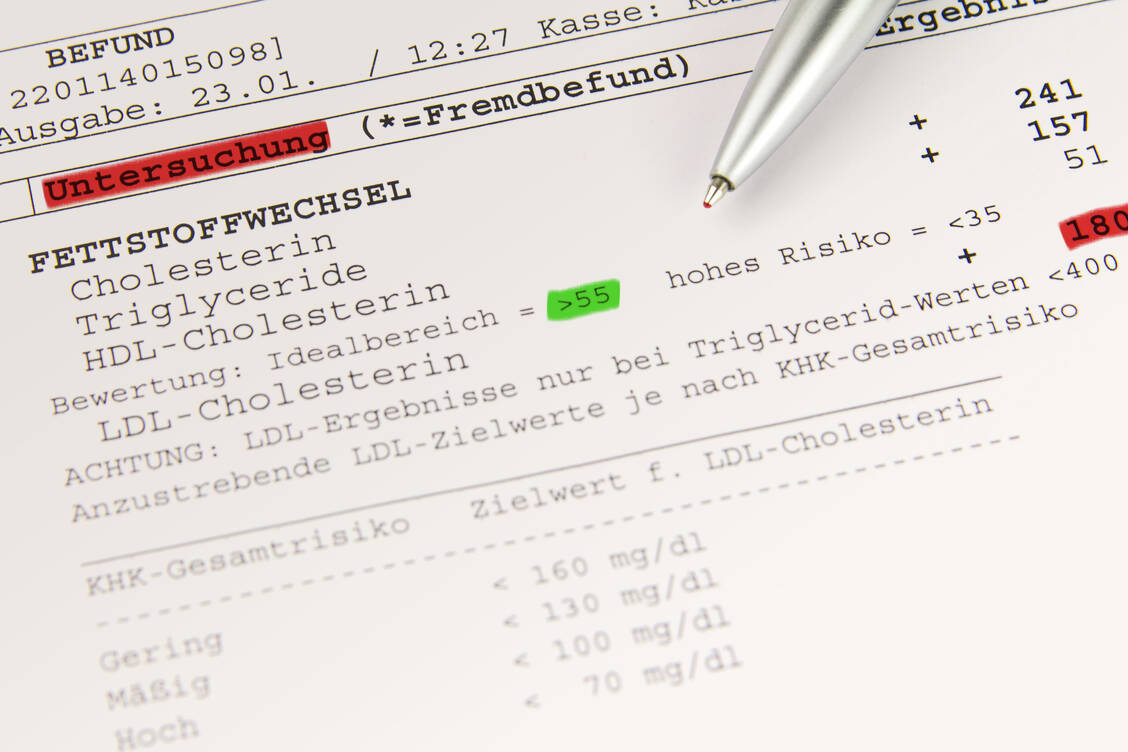Der Blutdruck sollte nach einem Hirninfarkt oder einer TIA langfristig auf unter 140/90 mmHg gesenkt werden. Unter Beachtung der Verträglichkeit und der Vorerkrankungen sowie des Alters des Patienten kann der systolische Blutdruck auf 120 bis 130 mmHg gesenkt werden (1). Da Captopril eine sehr kurze Halbwertszeit von circa zwei Stunden aufweist, empfiehlt sich die Umstellung auf einen lang wirksamen ACE-Hemmer, zum Beispiel Ramipril 5 mg einmal täglich oder Perindopril 5 mg einmal täglich.
Gemäß der Nationalen Versorgungsleitlinie Hypertonie sind zur Behandlung der arteriellen Hypertonie nach einem Schlaganfall bevorzugt Calciumkanalblocker oder ACE-Hemmer empfohlen. Alternativ können auch Thiazid-Diuretika eingesetzt werden (8). Aufgrund des zusätzlich begleitenden Diabetes sollen ACE-Hemmer oder Sartane bevorzugt werden. Auch der Einsatz von Calciumantagonisten ist möglich.