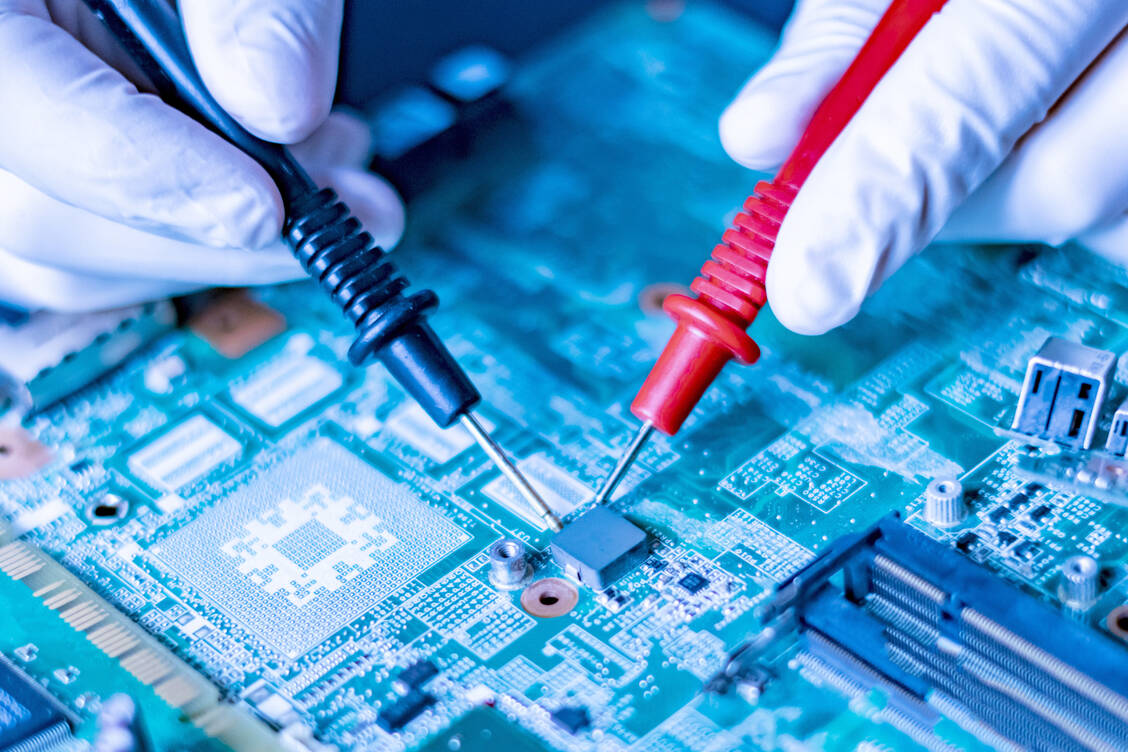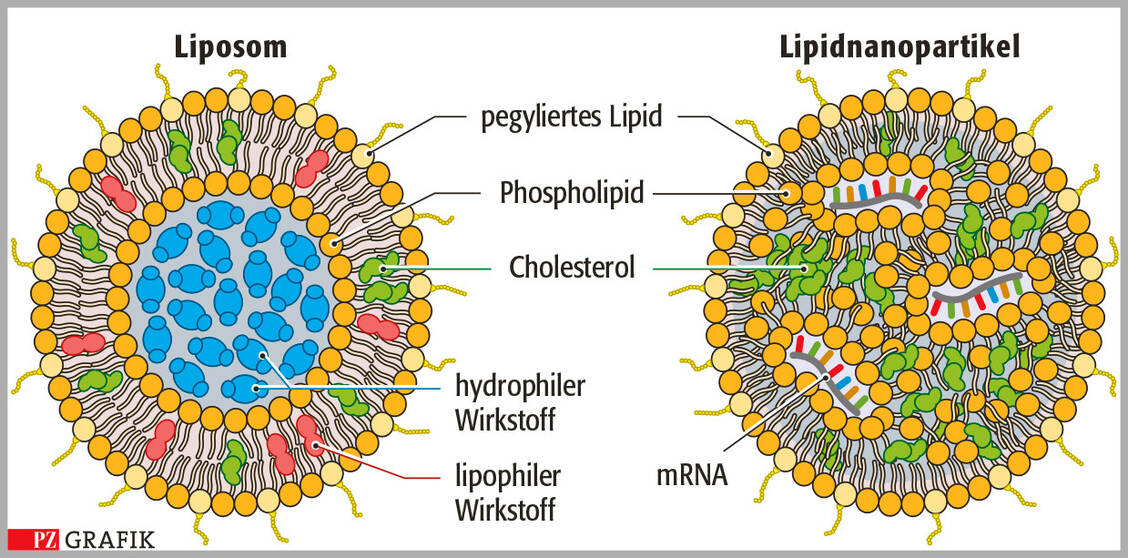In der pharmazeutisch-medizinischen Anwendung spricht man allgemein von Nanotechnologie, wenn die Strukturen kleiner als 1 Mikrometer (10-6 m) sind. Zum Vergleich: Die meisten Arzneiformen, mit denen Apotheker in ihrem Beruf heute konfrontiert werden, haben Ausmaße im Millimeter- oder Zentimeterbereich.
Da die Nanotechnologie die Eigenschaften von Materialien gezielt verändern kann, ist sie in vielen Bereichen besonders wichtig. Unter dem Gesichtspunkt des Marktvolumens hat Nanotechnologie heute sicherlich die größte Bedeutung in der Elektronik und Chemie. Sowohl bei der Herstellung von Computerchips als auch bei Speichermedien kommt sie zum Einsatz und ermöglicht eine immer größere Leistungsfähigkeit der Systeme. In der Chemie sei beispielsweise auf nanotechnologische Oberflächenbeschichtungen verwiesen, die Stoffe schmutzunempfindlich machen, und auf nanopartikuläre Zusätze in Kunststoffen und Gummimischungen, die den Materialien ihre speziellen Eigenschaften wie Schlagfestigkeit, Antistatik oder Haftfähigkeit geben.