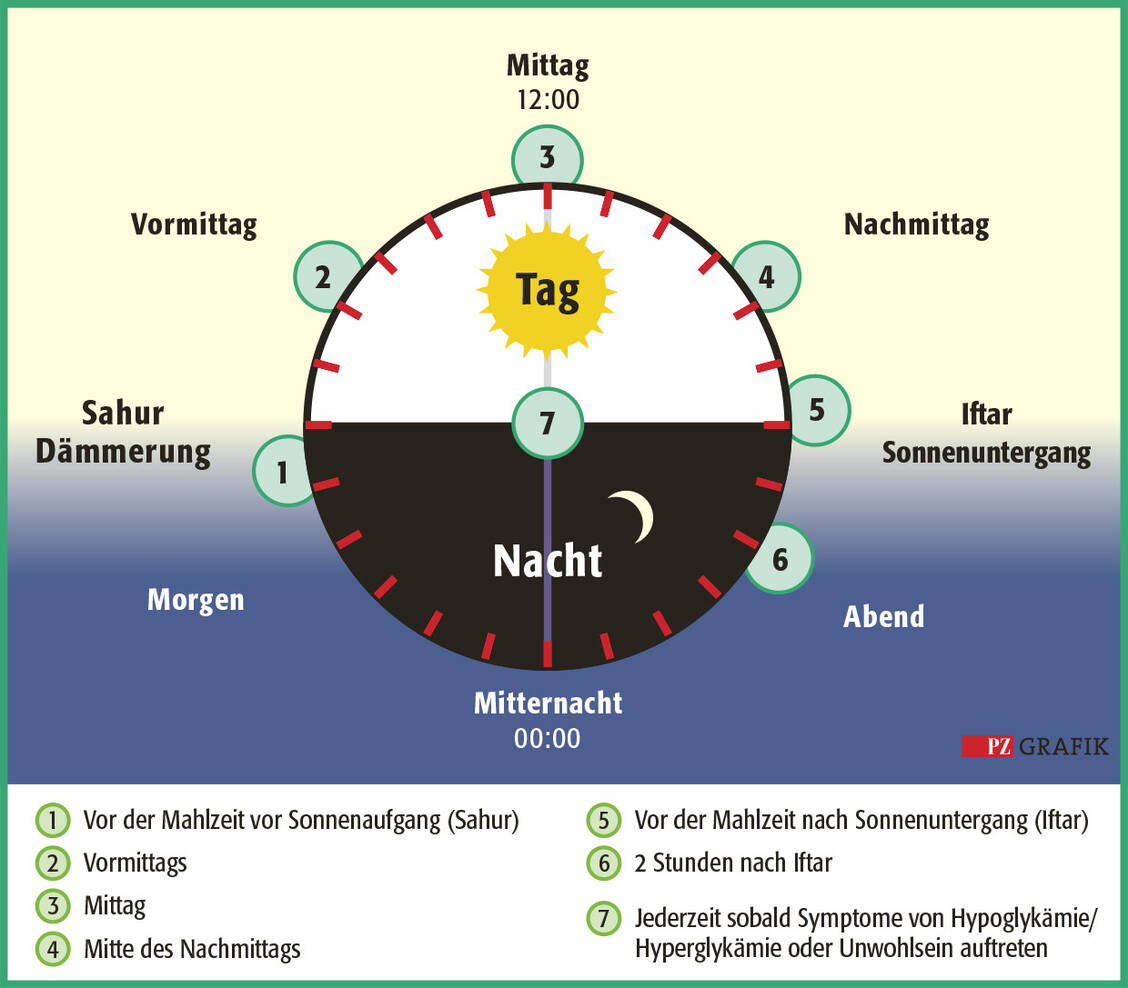Piktogramme können eine Option sein, um Sprachschwierigkeiten zu überwinden. Jedoch sind die Bildsymbole nicht selbsterklärend. Ihr Code muss wie bei einem fremden Verkehrszeichen erst erlernt werden. Dies wurde besonders deutlich, als die Piktogramme der U.S. Pharmacopoeia (USP) in vielen anderen Ländern der Welt zum Einsatz kamen. Sie lösten je nach Vorkenntnissen des Betrachters auch Missverständnisse aus.
Die internationale Dachorganisation der Apothekerinnen und Apotheker, die Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP), befürwortet die Nutzung von Piktogrammen. Sie hat die Zeichenserie der USP um Bilder erweitert, die häufige Nebenwirkungen illustrieren sollen. Vier Symbolformen charakterisieren die Abbildungen, ähnlich wie im Straßenverkehr: Dreiecke stehen für Nebenwirkungen, Quadrate für Indikationen, Kreise für obligatorische Maßnahmen und durchgestrichene Kreise für Verbote.
Es ist wichtig, nur Piktogrammsätze zu verwenden, die als zusätzlichen Hilfsanker für den Kontext Wörter und Begriffe in der Muttersprache des Patienten zum jeweiligen Bild beinhalten. Piktogrammsätze wie der der Apothekerkammer Niedersachsen, die nur deutschsprachige Bildunterschiften haben, sollten nicht verwendet werden. Sicherer können die Zeichen bei Menschen eingesetzt werden, die zwar gut Deutsch sprechen, aber Defizite beim Lesen haben. Hier sind unterstützende Bildunterschriften nicht immer erforderlich.
Die Abbildung von Körperteilen wird in den Kulturen unterschiedlich interpretiert. Symbole mit unbekleideten Körperteilen können unter Umständen das Schamgefühl verletzen oder als anzüglich missverstanden werden.