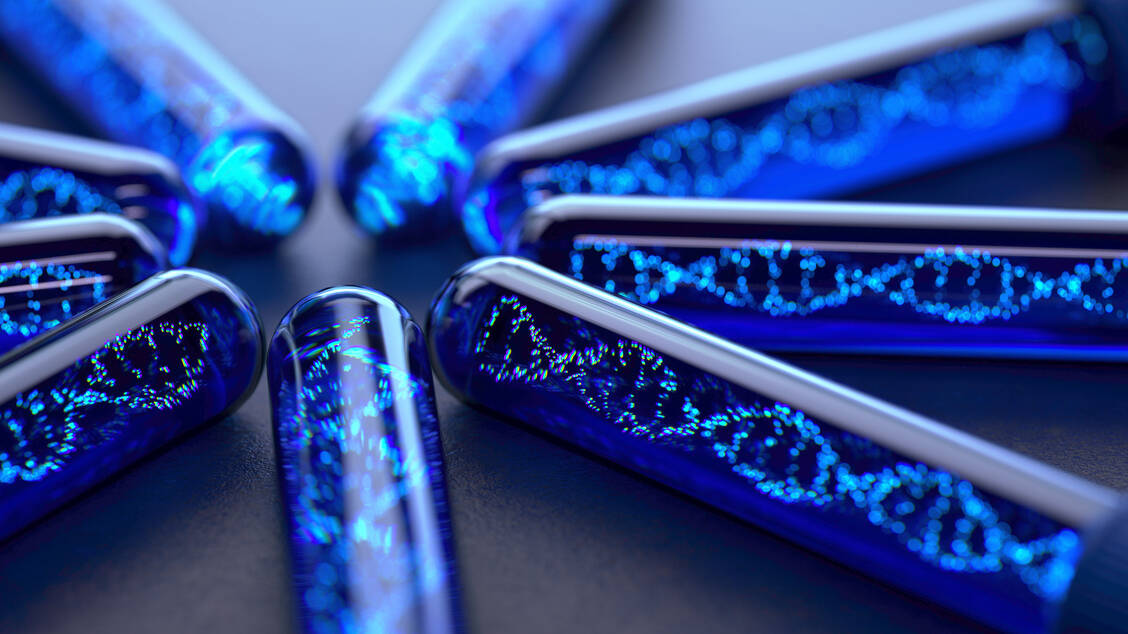In der Entwicklungsgeschichte der Gentherapie gab es viele Hochs und Tiefs. Limitiert wurde das prinzipiell so plausible Konzept nicht etwa durch technische Schwierigkeiten, sondern durch die Unvorhersehbarkeit der biologischen Konsequenzen, die durch ein Stück Fremd-DNA verursacht wurden.
Endlich glaubte man, mit der Verwendung eines AAV-Vektors die Probleme in den Griff bekommen zu haben. Und tatsächlich waren die Studien so überzeugend, dass bereits Zulassungen sowohl seitens der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA als auch der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) erteilt wurden.
Diese gute Stimmung trüben nun wieder einmal Studien an Hunden, bei denen gezeigt wurde, dass nach einer zehnjährigen Beobachtungszeit in etlichen Zellen der Tiere Fragmente der eingeführten DNA ins Genom integriert worden waren. Genau dies wird von Gentherapeuten so gefürchtet.
Experten bewerten die Beobachtung nicht einheitlich. Deutlich wird aber hier wieder einmal, dass jede therapeutische Intervention mit Restrisiken behaftet ist. Das gilt umso mehr für Therapien, die trotz einer Zulassung letztlich immer noch dem Bereich der experimentellen Medizin zuzuordnen sind.
Theo Dingermann, Chefredakteur