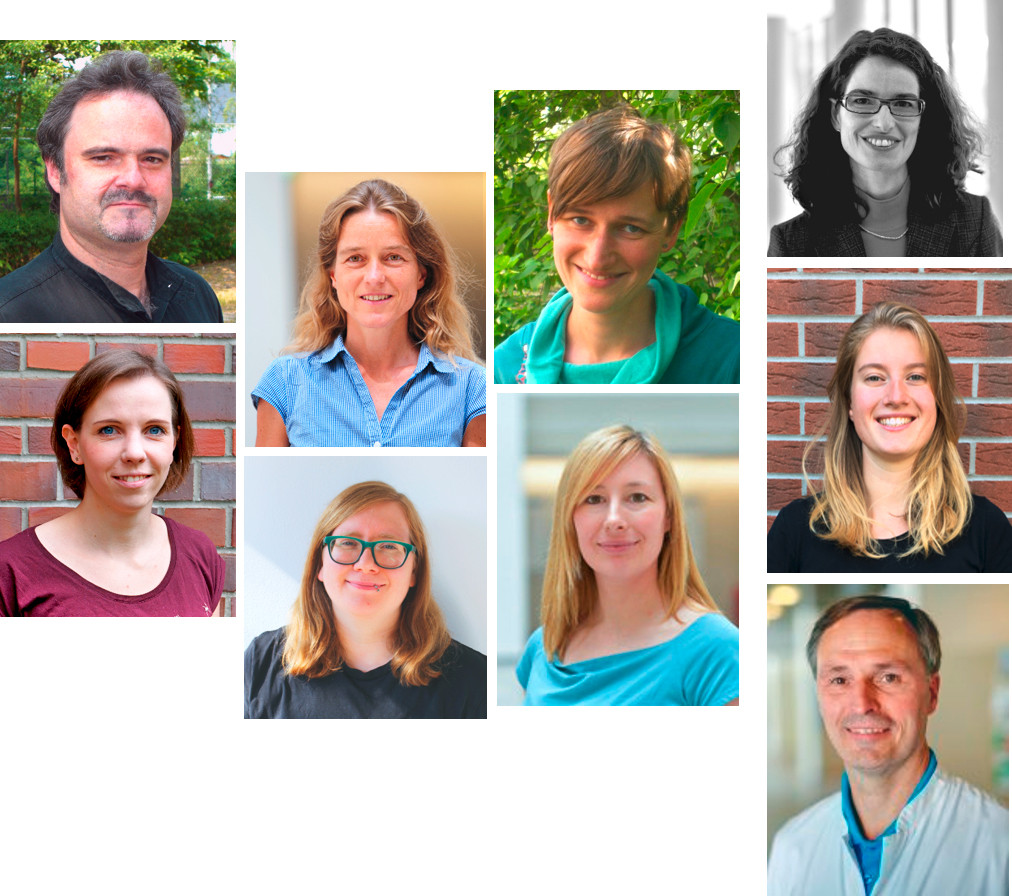»Ziel des Projekts ist es, Studierende beider Professionen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit im späteren Berufsleben vorzubereiten. Dahinter steht natürlich der Gedanke, die Patientensicherheit zu erhöhen«, erklärt Allgemeinmedizinerin Dr. Sabine Gehrke-Beck von der Charité im Gespräch mit der PZ. Mediziner und Pharmazeuten sollen die gegenseitige Profession näher kennenlernen, um einen Blick dafür zu bekommen: »Was kann der andere eigentlich und wie kann er mich in meiner Arbeit unterstützen?« Es geht also nicht darum, Inhalte aus dem jeweils anderen Fachbereich zu erlangen. Der Fokus liegt vielmehr darin, die Kompetenzen des anderen kennenzulernen und zu verstehen, dass sich diese bei Pharmazeuten und Medizinern unterscheiden, jedoch gut ergänzen.