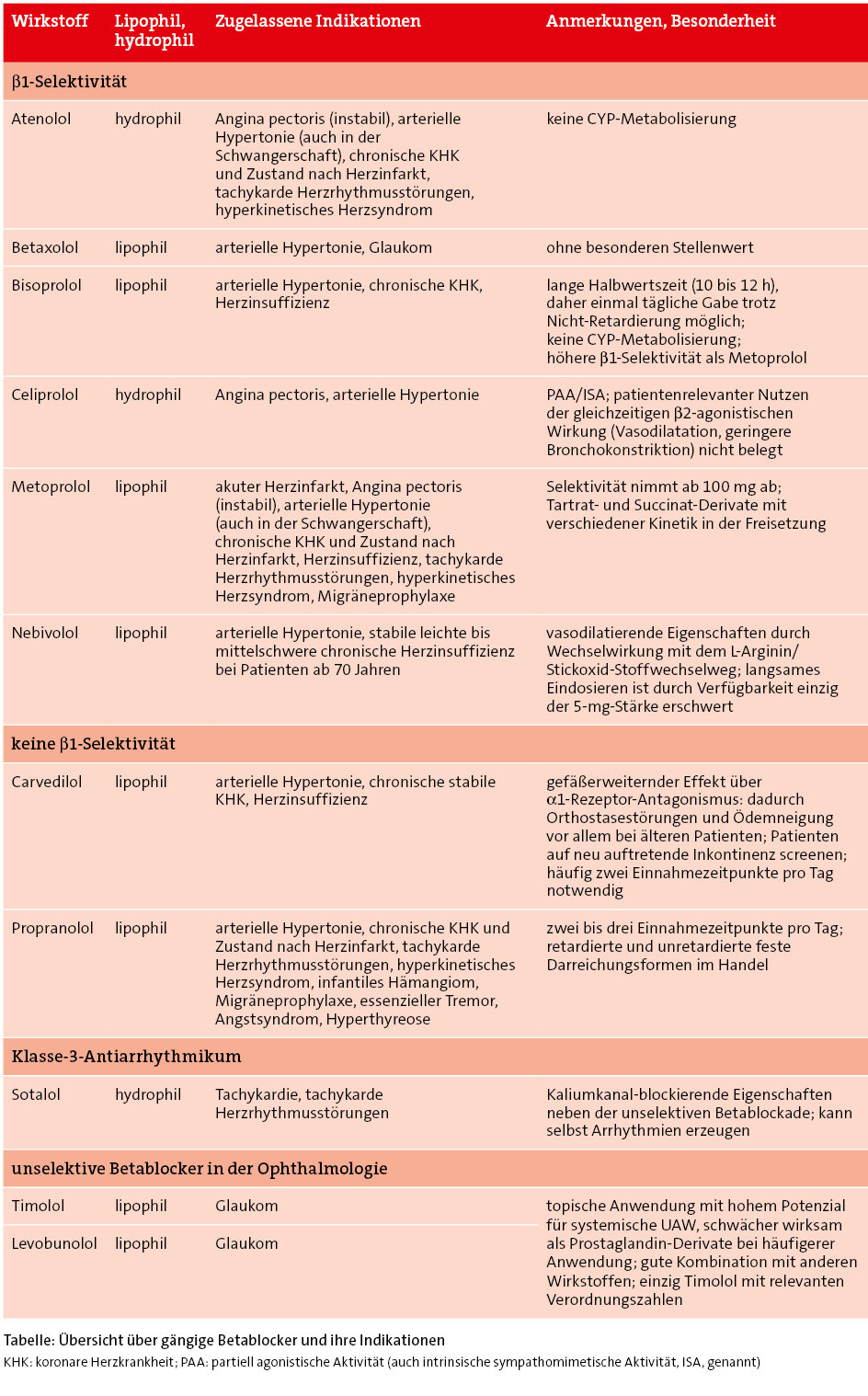Metoprolol ist – nach Bisoprolol – der am zweithäufigsten eingesetzte Betablocker und hat ein breites Anwendungsfeld. Es kann intravenös (Metoprololtartrat) und peroral (Metoprololtartrat und -succinat) verabreicht werden. Parenteral wird es im akuten Herzinfarkt nur bei hämodynamisch stabilen Patienten (systolischer Blutdruck mindestens 100 mmHg, Herzfrequenz über 60/min) verwendet, wenn keine Kontraindikationen bestehen. Daran schließt sich die perorale Gabe an.
In der Rezidivprophylaxe und bei chronischen Erkrankungen unterscheiden sich die Salze Metoprololtartrat und -succinat in der Anwendung und im Nutzen. Metoprololtartrat ist als sofort freisetzende und als retardierte Formulierung mit Wirkstofffreisetzung 1. Ordnung erhältlich. Um eine 24-stündige Wirkung zu erzielen, müssen beide zweimal täglich eingenommen werden. Darüber hinaus ist eine Retardfomulierung mit Wirkstofffreisetzung 0. Ordnung erhältlich; dies ist sichtbar an Namenszusätzen wie ZOK (Zero Order Kinetik), ZOT (Zero Order Technologie), ZK (Zero Kinetik), ZNT (Zero neue Technologie), NT (neue Technologie), NK (neue Kinetik) oder O.K. (0. Kinetik). Diese wirken wie Metoprololsuccinat über 24 Stunden.
Das Succinat hat die gleichmäßigsten Wirkspiegel über den Tag, sodass eine Aufsplittung der Dosis in jedem Fall unnötig ist.
Die β1-Selektivität geht bei einem gewöhnlichen Stoffwechsel ab 100 mg (Tartrat) beziehungsweise 95 mg (Succinat) zunehmend verloren.
Metoprololsuccinat-Präparate dürfen nicht gemörsert, aber geteilt und suspendiert werden, denn der Retardierungseffekt wird über kleine Cellulose-Perlen erreicht. Bei der Behandlung einer Herzinsuffizienz zeigte sich für die Freisetzung 0. Kinetik ein Vorteil in Hinblick auf die Mortalität durch gleichmäßigere Hemmung des Sympathikotonus (MERIT-HF-Studie).
Bei Patienten mit CYP2D6-Polymorphismus kann es erforderlich sein, die Dosis anzupassen. Denn es kann zu einem beschleunigten oder verlangsamten Wirkstoffabbau im Körper kommen. Auch bei der Bewertung von Interaktionen ist dieser Metabolismus zu berücksichtigen.