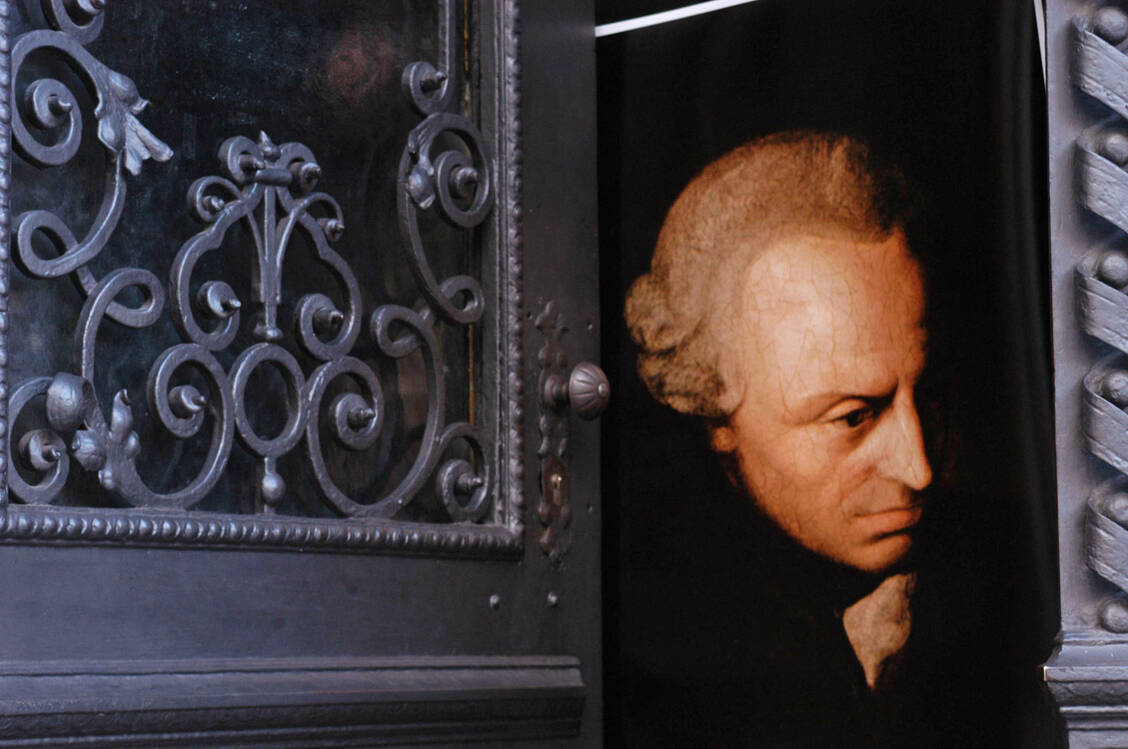War Kant hungrig, wurde er ungeduldig, wenn die Gäste sich zierten und die Essensverteilung verzögerten. »Gleich nach der Suppe nahm er einen Schluck, wie er es nannte, der aus einem halben Glase Magenwein, Ungar, Rheinwein, oder auch in Ermangelung jener, aus Bischof bestand« [5]. »Es ist gut, dass man manchmal zur Weckung der Lebensgeister Wein trinke« [9]. »Mit ausserordentlicher Lustigkeit klopfte er auf den Tisch, öffnete ein bouteille und schenkt ein. Jeder von uns musste zwei Gläser trinken, und er trank auch mit« [9]. »Auch trinkt er täglich einige Gläser Wein, zuerst weissen, dann rothen. Wenn er, was er aber jetzo nicht mehr thut … ausser Hause speiset, so trank er auch wohl ein Gläschen zuviel« [9].