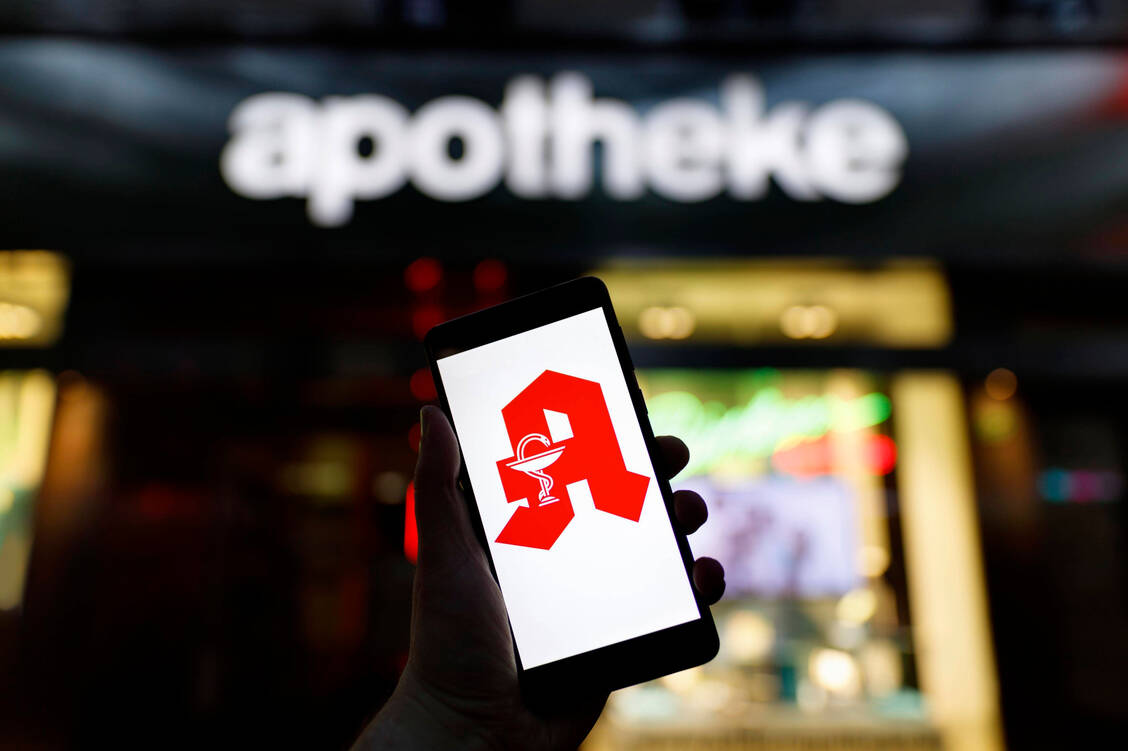Aus Sicht der Landesdatenschutzbeauftragten Marit Hansen ist aber genau dieses Übermittlungsverfahren nicht zulässig. Sie bemängelt, dass man Rezept- und Patientendaten nach dem Einlesen des E-Rezept-Codes in der App frei einsehen kann. In ihrem Schreiben an die KVSH, das der PZ vorliegt, erklärt Hansen ihre Bedenken mit dem Konzept von Smartphone-Apps aus dem Apothekenmarkt, bei denen genau diese Code-Weiterleitung praktiziert wird: »Dabei ist zu berücksichtigen, dass auf dem Markt frei erhältliche Apps aus dem Apothekenumfeld jeder Person, die befugt oder unbefugt im Besitz des jeweiligen QR-Codes ist, die Kenntnisnahme von in der Telematikinfrastruktur der Gematik enthaltenen Daten einer Verordnung zu verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ermöglicht: Beim Einlesen von QR-Codes in solche Apps werden die Verordnungsdaten ermittelt und den App-Nutzenden angezeigt.«