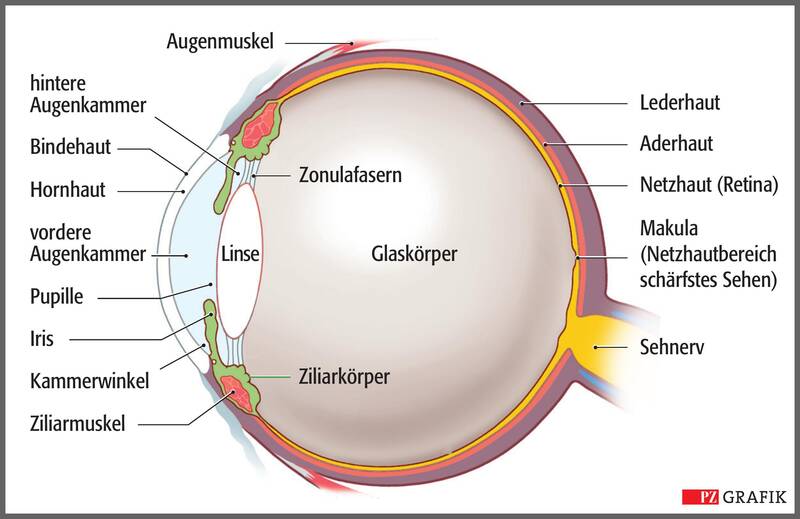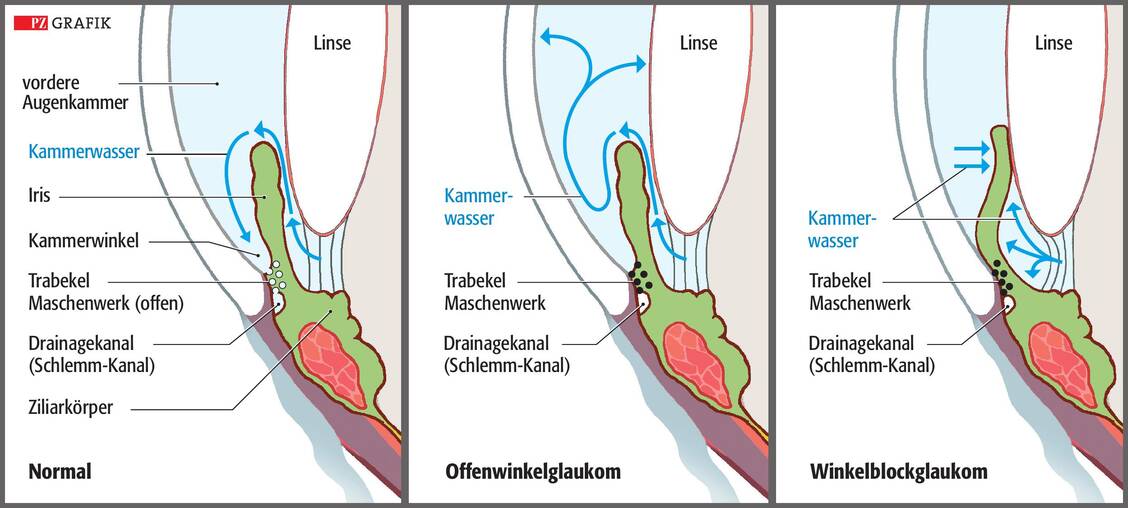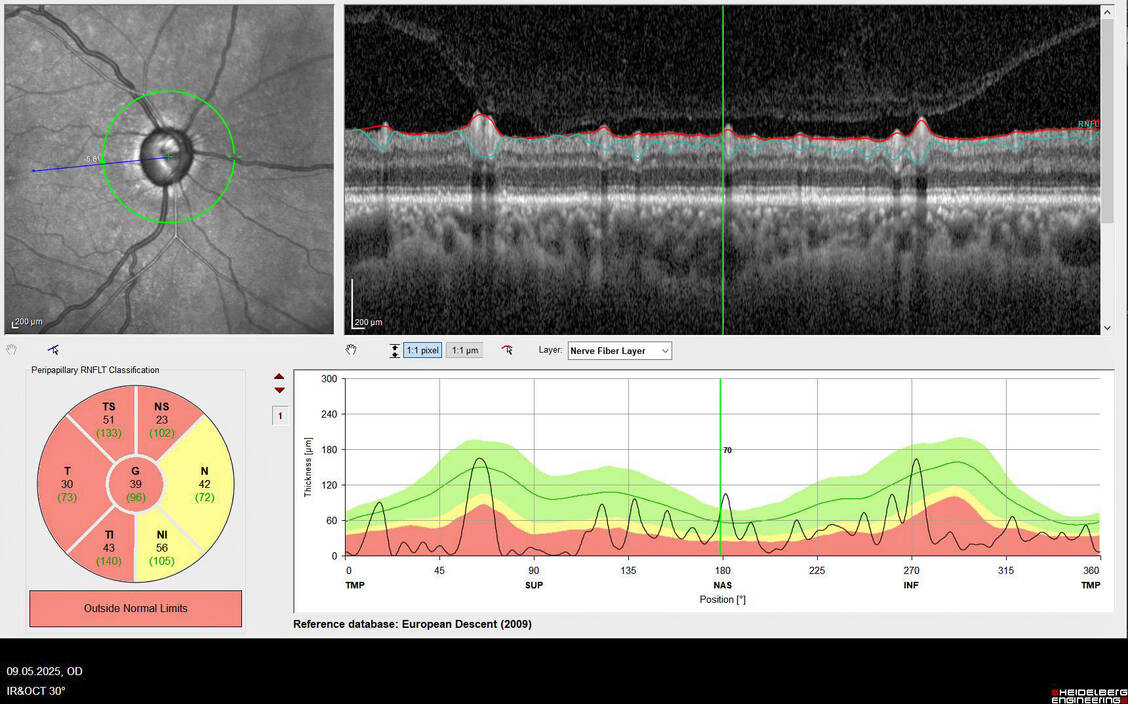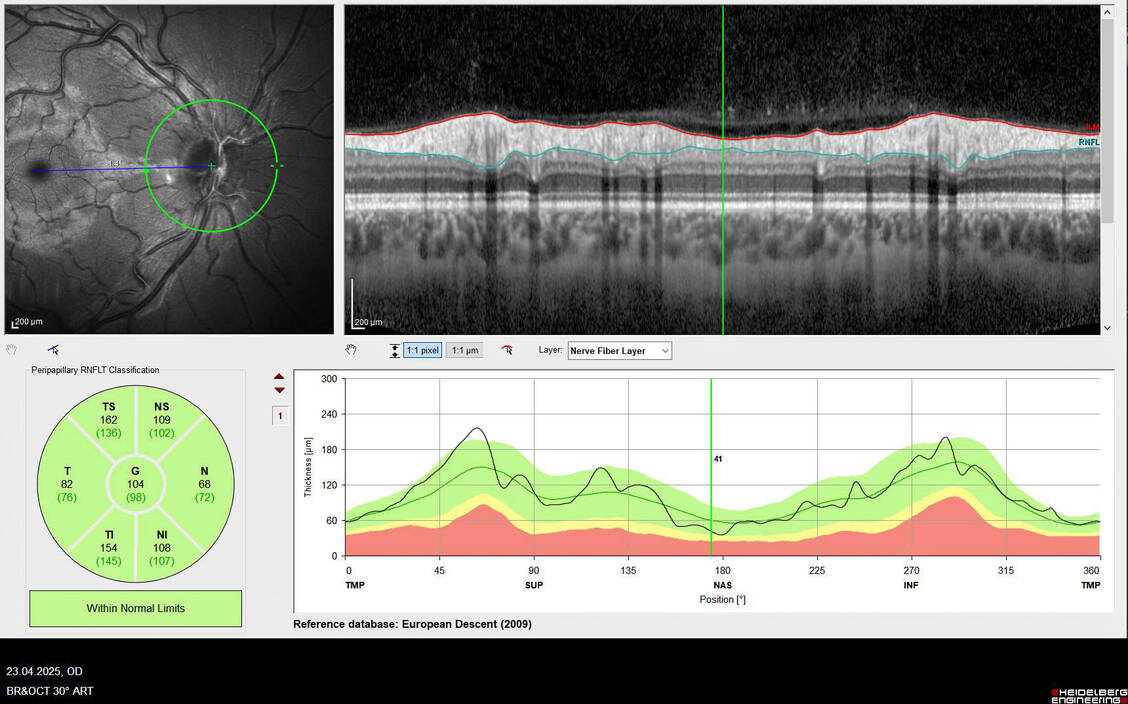Beim Glaukom als chronisch fortschreitende Erkrankung ist eine gute Adhärenz des Patienten entscheidend für den Therapieerfolg. Die Non-Adhärenz ist besonders hoch bei Krankheiten ohne direkten Leidensdruck, beispielsweise bei arterieller Hypertonie, Diabetes oder eben beim Glaukom. Publizierte Daten belegen für Glaukompatienten eine Non-Adhärenz-Rate von 30 bis 80 Prozent, die sich mit zunehmender Therapiedauer und Anzahl der Medikamente weiter erhöht.
Ein wichtiger Aspekt ist die subjektive Wahrnehmung von Gesichtsfelddefekten im Alltag. Eine Studie hat gezeigt, dass selbst fortgeschrittene Defekte wie schwarze Flecken oder ein schwarzer Tunnel subjektiv nicht wahrgenommen werden, da das Gehirn fehlende Informationen ergänzt (5). Deshalb sehen Glaukompatienten häufig keine Notwendigkeit einer Therapie.
In einer Kohortenstudie der AOK Nordost mit 250.000 Teilnehmern lösten 33,5 Prozent der Glaukompatienten ihre Rezepte nicht regelmäßig ein. Alter, Erkrankungsdauer, Pflegestufe und Multimorbidität wirken sich zusätzlich negativ auf die Adhärenz aus (6). Dasselbe gilt auch für kognitive Faktoren wie Vergesslichkeit oder Demenz oder physikalische Einschränkungen durch Arthritis und Tremor, die die Anwendung der Augentropfen zur Herausforderung werden lassen.