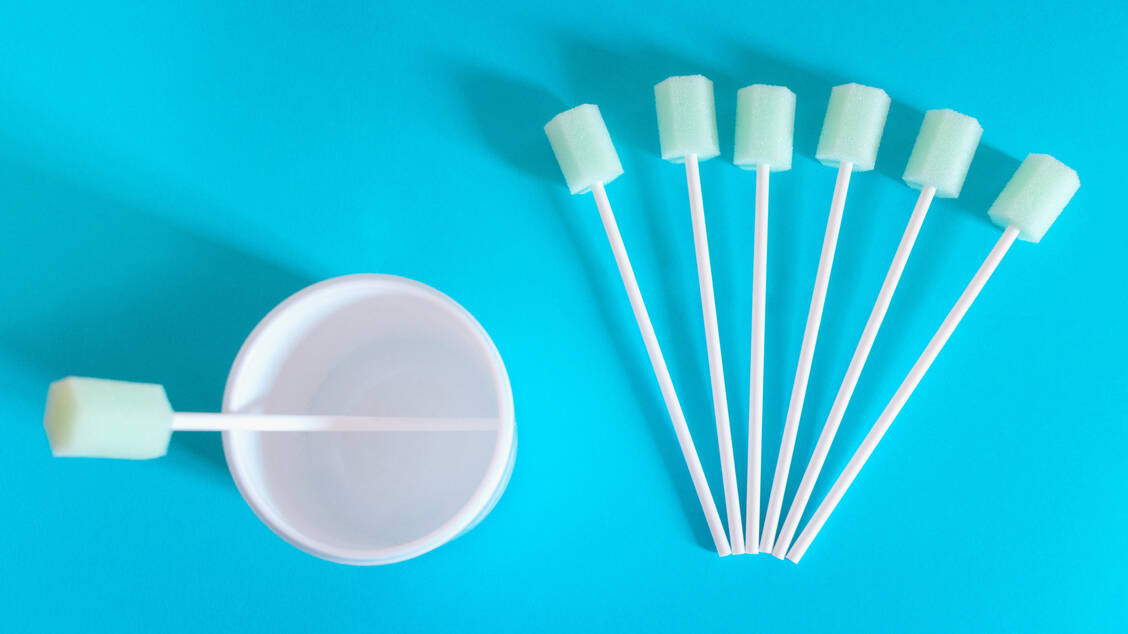Beispiel: 76-jähriger Mann mit ausgeprägt metastasiertem Prostatakarzinom mit Darmverschluss bei Peritonealkarzinose mit ausgeprägtem Ascites, Pleuraergüssen und massiven peripheren Ödemen. Von einer primären Punktion der Ergüsse sahen die Ärzte ab, da keine Dyspnoe bestand. Eine parenterale Ernährung mit 1500 kcal/1,5 l pro Tag hätte die Wassereinlagerungen nur verschlimmert oder Ascites- und Pleurapunktionen nötig gemacht (mit ausgeprägtem Eiweißverlust über die Drainagen). Alle anderen Symptome waren gut unter einem Mischperfusor kontrolliert. Das Ziel der Ernährung war es, für die verbleibenden Tage die Kognition und Vigilanz so aufrechtzuerhalten, dass der Mann seine Forschungsarbeiten noch an Kollegen übergeben konnte. Da der Hirnstoffwechsel vorrangig Glucose benötigt, bekam der Patient 250 ml Glucose 20 Prozent über Port untertags. Er konnte über eine Woche lang viele Gespräche mit seinen Kollegen führen, ohne dass die Überwässerung oder andere Symptome zunahmen, bevor er ruhig verstarb.
Beispiel: 57-jährige Frau mit Ovarialkarzinom mit Peritonealkarzinose und Ileus. Sie wurde von einer gynäkologischen Klinik auf die Palliativstation mit laufender parenteraler Ernährung über Port (1500 kcal/1,5 l/d) verlegt. Ihr Ehemann war Tag und Nacht bei ihr. Am zweiten Tag äußerte die Patientin, dass sie die parenterale Ernährung beenden wolle, um das Sterben nicht weiter hinauszuzögern. Nach ausführlichen Gesprächen mit ihr und ihrem Mann, der ihre Entscheidung mittrug, wurde die parenterale Ernährung beendet. Am übernächsten Tag gestand die Patientin, dass sie ein ausgeprägtes Hungergefühl habe, worunter sie stark leide. Mit der Infusion von 250 ml Lipofundin MCT 20 Prozent untertags verschwand das Hungergefühl. Die Patientin verstarb nach drei Tagen im Beisein ihres Mannes ruhig und unter guter Symptomkontrolle.
Beispiel: 87-jähriger Mann mit demenziellem Syndrom in der Phase des aktiven Laufens mit deutlichem Gewichtsverlust und vermindertem Appetit; auffällige und in den letzten Wochen rasante Verschlechterung des Allgemeinzustands. Zu diesem Zeitpunkt war es fraglich, wie lange der Patient noch zu leben hätte, wenn der Gewichtsverlust so weiterginge. Die Schwiegertochter des Patienten, mit der er in einem Mehrgenerationenhaushalt lebte, kam in die Apotheke, um für ihn eine geeignete Trinknahrung zu kaufen und einen letzten Versuch zu starten, ihn wieder »aufzupäppeln«. Da er Erdbeeren mochte, war die Geschmacksrichtung klar und die Empfehlung war, täglich eine bis zwei Flaschen zur ergänzenden Ernährung anzubieten. Der Anfang verlief schleppend; der Patient nahm die Trinknahrung zwar an, es musste jedoch eine Bezugsperson dabeisitzen und sie ihm immer wieder anbieten. Schon in den ersten Wochen danach stabilisierte und erhöhte sich sein Gewicht langsam und sein Gesundheitszustand verbesserte sich. Deshalb blieben die Angehörigen »dran«. Nach einigen Monaten war ihm die Trinknahrung zur angenehmen Gewohnheit geworden. Er lebt weiter stabil und zur familiären Zufriedenheit in seinem häuslichen Umfeld.