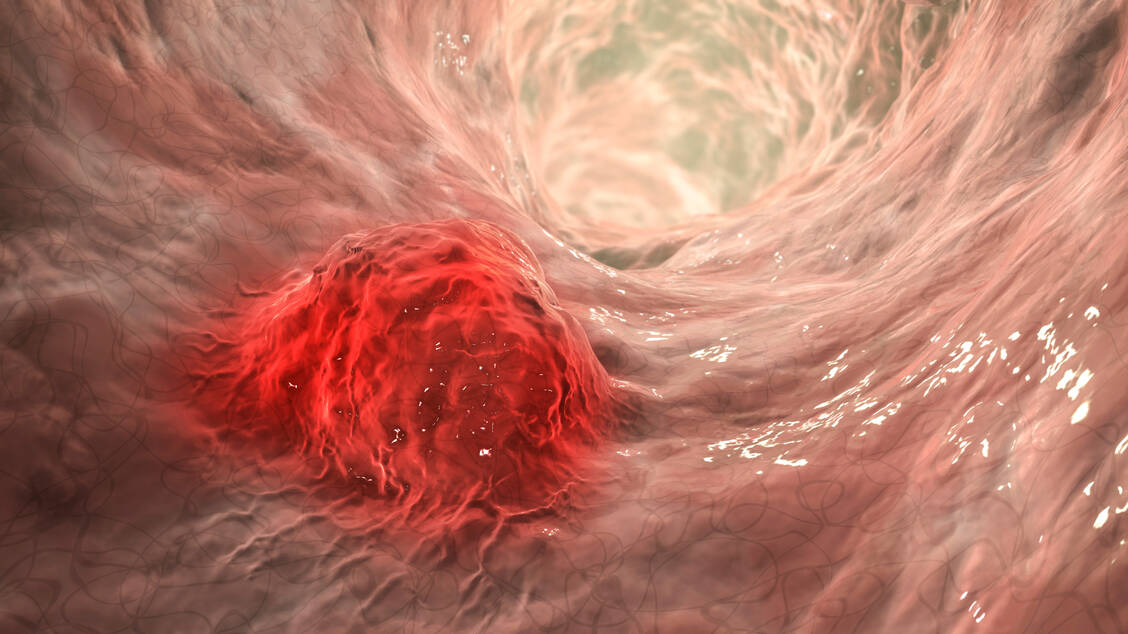Gängig sind auch die Parameter Gesamtansprechrate, Remissionsdauer und progressionsfreies Überleben. Die Gesamtansprechrate (Overall Response Rate, ORR, auch Remission Rate genannt) ist die Summe der relativen Häufigkeiten von kompletter Remission (CR: das Verschwinden aller nachweisbaren Tumorbefunde für mindestens vier Wochen) und partieller Remission (PR: die Reduktion der Tumormasse um mindestens 50 Prozent für mindestens vier Wochen ohne Neuauftreten von Tumormanifestationen und ohne Progression irgendeines Tumorparameters). »Auch eine Stable Disease (no remission), also keine Verschlechterung der Erkrankung, wird noch als Ansprechen aufgefasst, vor allem bei langsam wachsenden Tumoren«, ergänzte Barth.