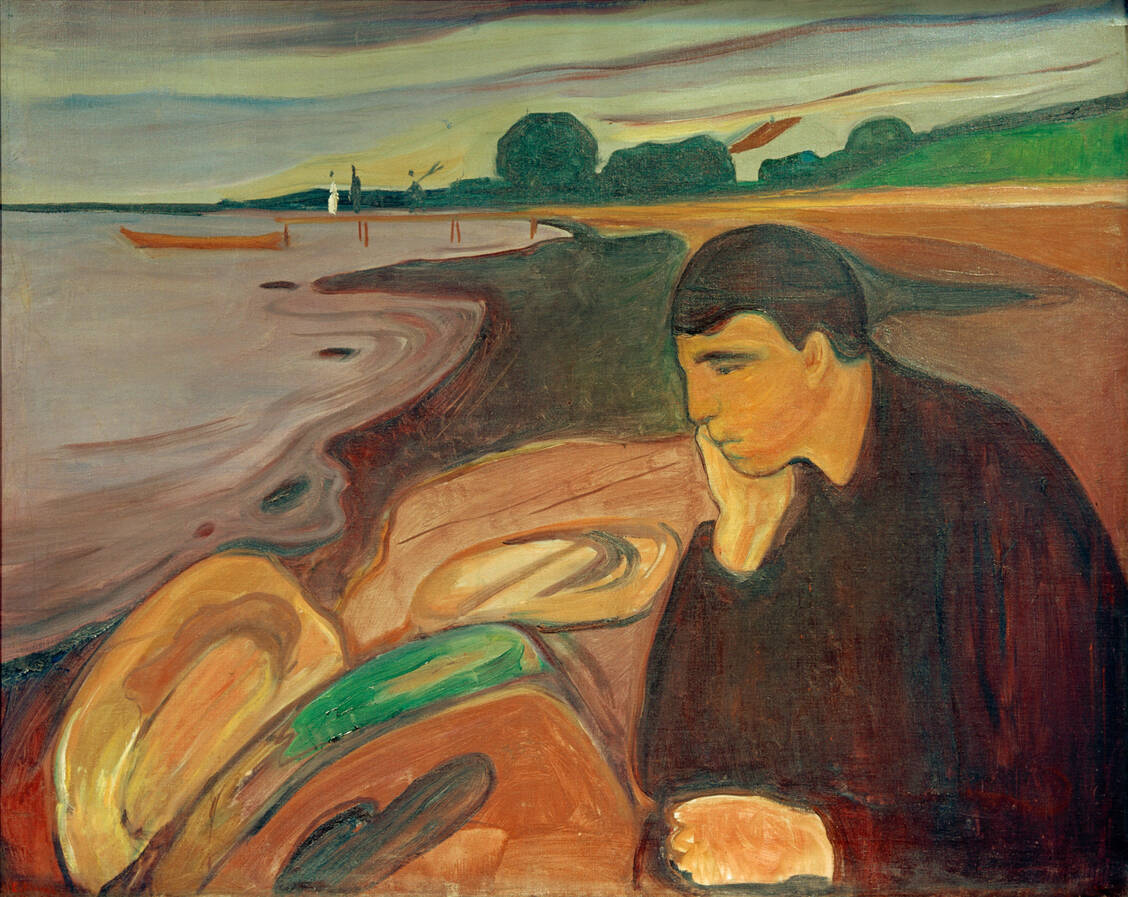Wissenschaftler sind sich einig, dass der niederländische Maler Zeit seines Lebens unter Temporallappen-Epilepsie, Verlustängsten und vermutlich sogar einer bipolaren Störung litt. Auch soll er zeitweise Symptome einer Porphyrie gezeigt haben. Diese seltene Stoffwechselerkrankung, die mit einer gestörten Bildung des roten Blutfarbstoffes Häm einhergeht, kann unter anderem kolikartige Bauchschmerzen hervorrufen. Entsprechende Attacken seien durch seine schlechte Ernährung und den regelmäßigen Gebrauch von Absinth, Terpentinöl, Brandy und Kampfer begünstigt worden, heißt es. Ein Inhaltsstoff von Absinth ist Alpha-Thujon. Es hemmt den Gamma-Aminobuttersäure Typ A (GABAA) Rezeptor, der wiederum inhibitorisch auf Nervenzellen und die Reizweiterleitung wirkt.