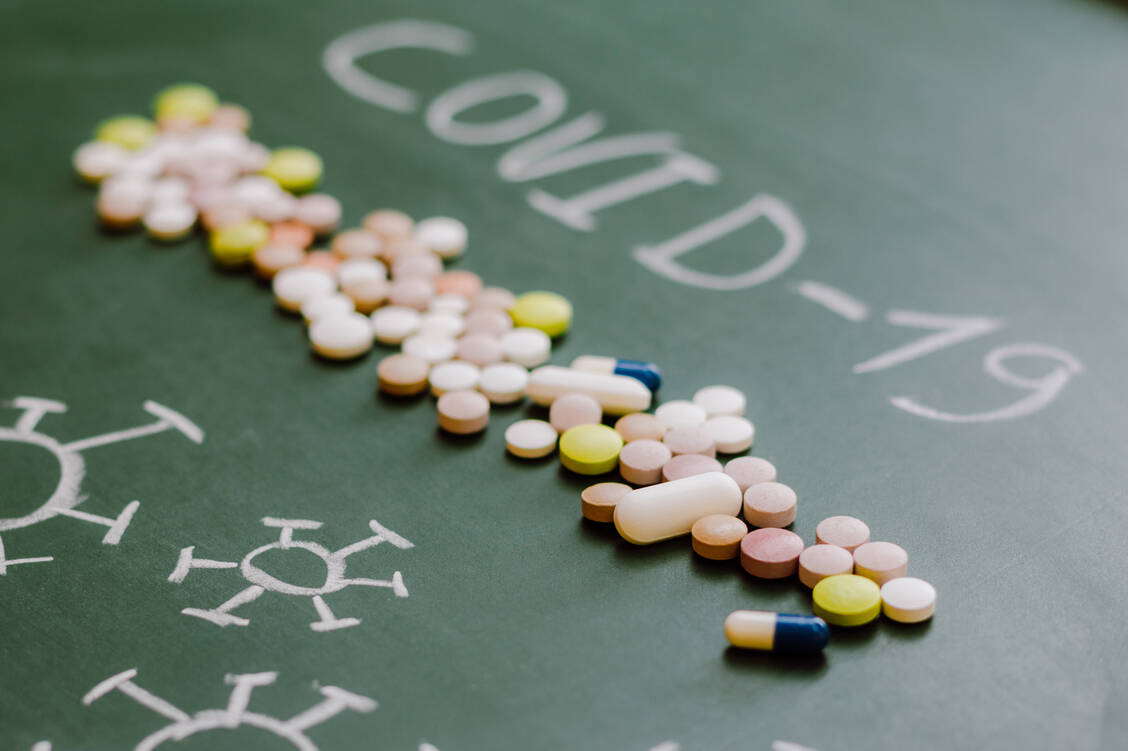»Derzeit gibt es keine zugelassenen Medikamente, die ausreichend wirksam sind und das Virus sowie die höchst unterschiedlichen Krankheitsverläufe und -symptome adressieren«, erklärte Dr. Daniel Vitt, Geschäftsführer von Immunic bei einer Pressekonferenz der Initiative. Die angeschlossenen Unternehmen wollen hier verschiedene vielversprechende Substanzen nun in größerem Rahmen klinisch testen. Doch solche Studien sind sehr kostenintensiv, insbesondere in der entscheidenden Phase III, und das finanzielle Risiko bei einem Misserfolg ist groß. »Erste sehr ermutigende Ergebnisse haben uns in Anbetracht der dramatischen Situation sehr angespornt«, so Dr. Rainer Lichtenberger, Mitgründer und Geschäftsführer von Atriva Therapeutics. Die Medikamentenkandidaten der BEAT-COV-Initiative seien in ihrer Entwicklung bereits weit fortgeschritten und erfolgversprechend.