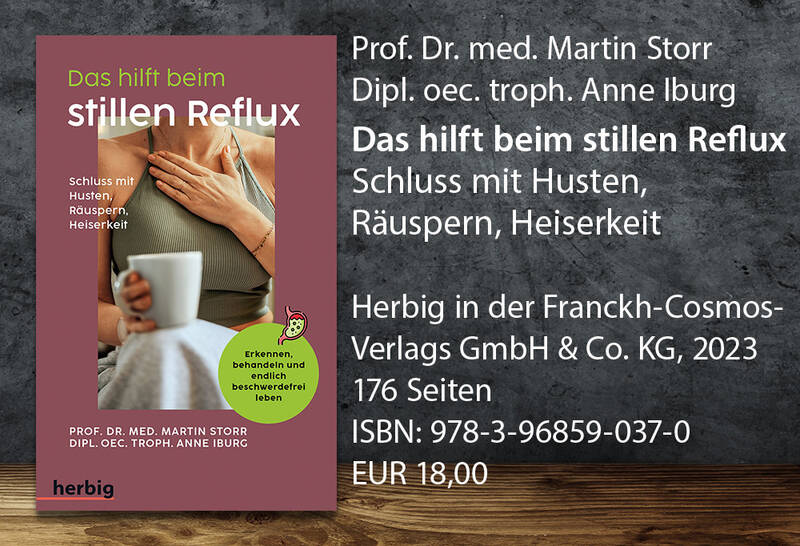Die Diagnose ist für Betroffene nicht selten mit einer Ärzte-Odyssee verbunden. Weil das Beschwerdebild medizinisch gesehen fächerübergreifend ist, gelingt oft die Zuordnung nicht. Man könnte den stillen Reflux laut Storr auch als »Verdachtsdiagnose bezeichnen, die vom Hals-Nasen-Ohren-Arzt gestellt und vom Gastroenterologen bestätigt wird«. Dieser nimmt eine Magenspiegelung vor sowie in Einzelfällen eine sogenannte 24-Stunden-Impedanz-pH-Metrie, also eine Säure-Refluxmessung per Magensonde. Damit lässt sich feststellen, ob der Mageninhalt bis zum oberen Schließmuskel der Speiseröhre aufsteigt.
Auch diese Methode ist nicht unbedingt aussagekräftig, zeigen Storrs Erfahrungen. Bei vielen Patienten sei die Menge des Rückflusses so minimal, dass die Refluxmessung einen Normalwert anzeigt, obwohl Beschwerden bestehen. »Eine negative Impedanz-pH-Metrie ist deshalb noch kein Beleg dafür, dass man nicht an einem stillen Reflux leidet«, heißt es im Buch.
Umso wichtiger sei eine gründliche Anamnese, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Beschreiben die Patienten etwa, dass ihr Husten mit der Nahrungsaufnahme oder bestimmten Körperpositionen zusammenhängt oder dass beim Vorneüberbeugen Missempfindungen im Halsbereich entstehen, seien das deutliche Hinweise auf den versteckten Reflux.