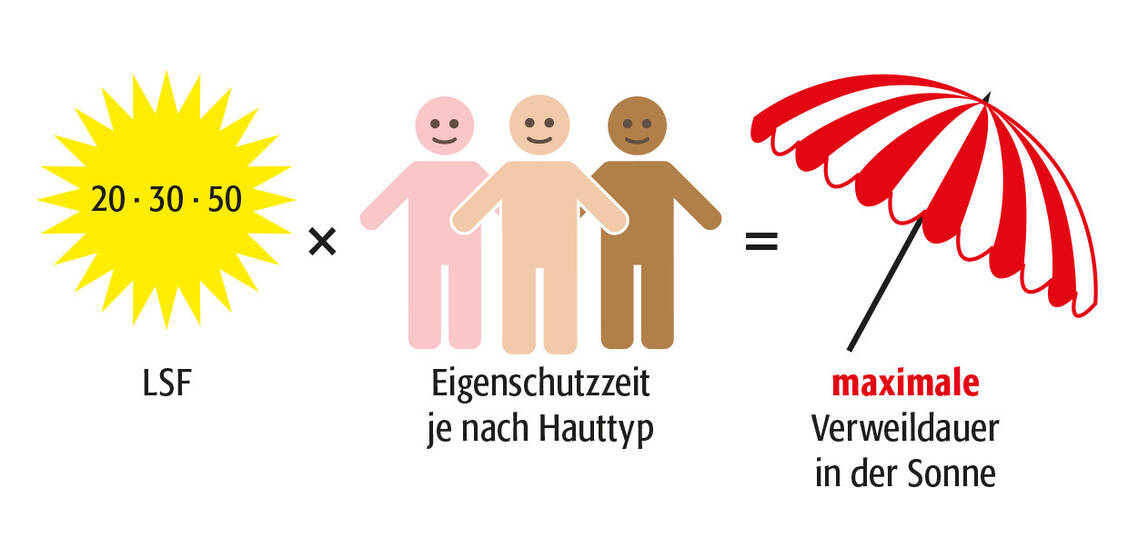Physikalische UV-Filter sind anorganische Substanzen wie Titandioxid oder Zinkoxid, die auch als mineralische UV-Filter bezeichnet werden. Sie reflektieren oder streuen das Sonnenlicht, sodass es nicht in tiefere Hautschichten gelangen kann. Die kleinen Teilchen sind auf der Haut sichtbar, was zwar eine gute Auftragskontrolle ermöglicht, einige Anwender jedoch stört. Um den »Weißeffekt« zu vermeiden, enthalten einige Sonnenschutzmittel mineralische Partikel im nanoskaligen Bereich. Um einen breiten UV-Schutz zu gewährleisten, werden in vielen Sonnenschutzpräparaten chemische und physikalische Filtersubstanzen kombiniert. Für UV-Filter existiert eine Positivliste mit Empfehlungen (Anhang VI der Kosmetikverordnung [EG] Nr. 1223/2009).