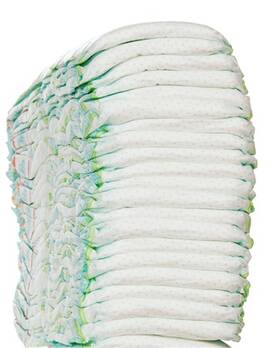Patienten, die unter Vedolizumab ein klinisches Ansprechen gezeigt hatten, erhielten randomisiert ab Woche 6 entweder Vedolizumab alle acht Wochen, Vedolizumab alle vier Wochen oder Placebo alle vier Wochen. Ein Jahr nach Therapiestart (Woche 52) waren unter Verum im Vier-Wochen-Rhythmus 45 Prozent der Patienten in klinischer Remission (primärer Endpunkt), unter Verum im Acht-Wochen-Rhythmus 42 Prozent und unter Placebo 16 Prozent. Patienten nach erfolgloser Anti-TNF-α-Therapie sprachen dabei mit 35 Prozent (Vier-Wochen-Rhythmus) beziehungsweise 37 Prozent (Acht-Wochen-Rhythmus) schlechter an als solche, bei denen eine konventionelle Therapie versagt hatte.
Das Design der GEMINI-II-Studie, an der 368 Patienten mit Morbus Crohn nach Versagen mindestens einer herkömmlichen Therapie teilnahmen, entsprach dem von GEMINI I. Neben der klinischen Remission in Woche 6 gab es einen weiteren primären Endpunkt, nämlich ein verbessertes klinisches Ansprechen in Woche 6. Ersteres erreichten 15 Prozent der Patienten unter Vedolizumab und 7 Prozent unter Placebo, Letzteres 31 Prozent unter Vedolizumab und 26 Prozent unter Placebo. Nach 52 Wochen waren 36 Prozent der vierwöchentlich mit Verum therapierten Patienten in klinischer Remission, 45 Prozent erfüllten die Kriterien für ein verbessertes klinisches Ansprechen. Für die im Acht-Wochen-Rhythmus therapierten Patienten betrugen die entsprechenden Prozentzahlen 39 beziehungsweise 44, für Placebo 22 beziehungsweise 30.
In GEMINI III erhielten 416 Morbus-Crohn-Patienten, bei denen mindestens eine herkömmliche Therapie versagt hatte, in den Wochen 0, 2 und 6 doppelblind entweder Vedolizumab 300 mg oder Placebo. Primärer Endpunkt war der Anteil Patienten in klinischer Remission in Woche 6 in der Untergruppe der Anti-TNF-α-Versager. Sowohl in Gemini II als auch in Gemini III zeigte sich somit auch in der Indikation Morbus Crohn, dass Patienten nach erfolgloser Anti-TNF-α-Therapie tendenziell schlechter auf Vedolizumab ansprachen.
Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse traten unter Langzeit-Behandlung bei 19 Prozent der mit Vedolizumab therapierten Patienten und bei 13 Prozent der mit Placebo behandelten Patienten auf. Die häufigsten Nebenwirkungen waren Nasopharyngitis, Arthralgie und Kopfschmerzen, gefolgt von Übelkeit, Infektionen der oberen Atemwege, Fieber, Müdigkeit und Husten. 4 Prozent der Patienten berichteten von infusionsbedingten Reaktionen.
Aufgrund seiner darmselektiven Wirkung hat Vedolizumab zwar keine systemische immunsuppressive Wirkung, doch kann unter der Therapie dennoch das Risiko für opportunistische Infektionen steigen. Akute schwere Infektionen wie Tuberkulose, Sepsis, Cytomegalie-Virus oder Listeriose sind daher Kontraindikationen. Wird bei der Untersuchung vor Beginn einer Vedolizumab-Therapie eine latente Tuberkulose entdeckt, muss zuerst eine Therapie dagegen eingeleitet werden, bevor die Vedolizumab- Behandlung beginnen kann. Es wird empfohlen, allen Patienten vor Beginn der Therapie alle Impfungen nach den aktuellen Impfempfehlungen zu verabreichen. Lebendimpfstoffe sollten Patienten unter Vedolizumab-Therapie nur gegeben werden, wenn der Nutzen die Risiken eindeutig überwiegt. Impfungen mit inaktivierten oder abgetöteten Impfstoffen sind aber möglich.
Gebärfähigen Frauen wird in der Fachinformation dringend empfohlen, geeignete Methoden zur Empfängnisverhütung anzuwenden und diese mindestens 18 Wochen nach der letzten Gabe von Vedolizumab fortzuführen. Während der Schwangerschaft darf der Antikörper nur dann zum Einsatz kommen, wenn der Nutzen das potenzielle Risiko für die Mutter und den Föten eindeutig überwiegt. Auch wird Frauen empfohlen, entweder das Stillen oder die Behandlung mit Vedolizumab zu unterbrechen beziehungsweise darauf zu verzichten.
- vorläufige Bewertung: Sprunginnovation