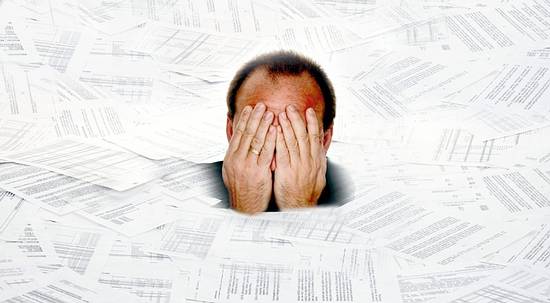In 80 bis 90 Prozent der Fälle sind die Erreger Escherichia-coli-Bakterien. Infektionen mit Enterobakterien oder Staphylokokken sind deutlich seltener, kommen aber bei komplizierten HWI prozentual häufiger vor als bei unkomplizierten. Da das Spektrum der auslösenden Keime gut bekannt ist, kann die Therapie in der Regel »kalkuliert« erfolgen, das heißt entsprechend dem zu erwartenden Erreger und der regional bekannten Resistenzsituation.
Bei unkomplizierten Infekten sind Fluorchinolone nicht die Mittel der ersten Wahl. Leider bestehen aber »in der antibiotischen Behandlung von Harnwegsinfekten beträchtliche Unterschiede zwischen den in Leitlinien formulierten Empfehlungen und dem tatsächlichen Verordnungsverhalten«, zitierte Teerling einen im vergangenen Jahr erschienenen Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt. Zunehmende Resistenzen, die den Einsatz von Fluorchinolonen für schwere Infektionen gefährdeten, seien die Folge. Teerling sprach in diesem Zusammenhang vom »Leid mit den Leitlinien«: Es gebe einfach zu viele und diese hätten zu kurze Halbwertszeiten, was die Umsetzung in der Praxis häufig vereitle.
Entsprechend den derzeitigen Empfehlungen sollten unkomplizierte HWI entweder mit einer Einmaldosis von 3 g Fosfomycin behandelt werden oder mit zweimal täglich 100 mg Nitrofurantoin retard über fünf bis sieben Tage. »Nitrofurantoin ist eigentlich eine Uralt- Substanz, trotzdem gibt es so gut wie keine Resistenzen dagegen«, berichtete Teerling. Da es sich um ein Hohlraumchemotherapeutikum handelt, werden mit Nitrofurantoin allerdings keine ausreichend hohen Gewebespiegel erreicht, weshalb es bei komplizierten HWI nicht indiziert ist. Mittel der zweiten Wahl sind Fluorchinolone, Cotrimoxazol und Trimethoprim.
Als kompliziert gelten alle Harnwegsinfektionen bei Kindern, Schwangeren und Männern sowie immer dann, wenn die Erreger ins Nierenbecken aufgestiegen sind. Sie erfordern eine längere Antibiotikagabe, in der Regel sieben bis zehn Tage. »Hier stehen die Fluorchinolone ganz oben auf der Empfehlungsliste«, sagte Teerling. Eine wichtige Nebenwirkung dieser Antibiotikaklasse sei die erhöhte Gefahr von Sehnenrupturen, die auch nach Ende der Therapie noch einige Wochen anhalte. »Daran sollten Sie vor allem bei jungen und ansonsten gesunden Patienten denken, die vielleicht eine Sportart mit hohem Verletzungsrisiko ausüben«, so Teerling. Bei Älteren könnten Fluorchinolone dagegen Verwirrtheitszustände auslösen. Generell kontraindiziert seien die Substanzen bei Epilepsie.
Zur Prävention von Harnwegsinfekten ist in den vergangenen Jahren Cranberrysaft in Mode gekommen, der aus der Großfrüchtigen Moosbeere (Vaccinium macrocarpon) gewonnen wird. Vermutlich wirkt der Saft über eine Hemmung der Bindungsfähigkeit von E. coli an die Urothelzellen. In einem Cochrane Review konnte eine Senkung der Infektionsrate gezeigt werden, allerdings war die Abbruchrate in den Studien aufgrund des unangenehmen Geschmacks des Saftes hoch. Teerling zufolge sollten mindestens 36 mg der in Cranberrysaft enthaltenen Proanthocyanidine pro Tag aufgenommen werden. Über die wirksamste Dosierung und Applikationsart herrsche zurzeit jedoch Unklarheit. Mögliche Wechselwirkungen mit Warfarin sowie eine Erhöhung der Oxalatspiegel im Urin sprechen gegen einen unkritischen Einsatz dieses Saftes.