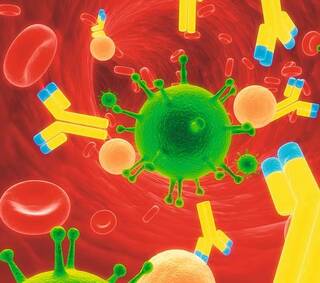Eines der wichtigsten Zielmoleküle ist Interleukin 2 (IL-2). »Dies ist der wichtigste Immunmodulator schlechthin«, sagte Zündorf. Die Wirkstoffe Ciclosporin, Tacrolimus und Rapamycin hemmen die IL-2-Synthese auf verschiedenen Ebenen. Seit Neuerem gibt es auch einen Antikörper, der die IL-2-Produktion drosselt. Basiliximab bindet den IL-2-Rezeptor, verhindert dadurch die positive Rückkopplung auf die IL-2-Synthese, weshalb weniger Zytokin gebildet wird.
»Ein weiterer dominanter Entzündungsmediator ist TNF-α«, sagte Zündorf »Deswegen tummeln sich hier auch die Wirkstoffe.« Zum Abfangen des Zytokins wurden die Antikörper Infliximab, Adalimumab, Golimumab, das Fusionsprotein Etanercept sowie das pegylierte Antikörperfragment Certolizumab pegol entwickelt.
Ein ebenfalls wichtiger Mediator ist Interleukin-1, gegen den sich drei Wirkstoffe richten: Der IL-1-Rezeptorantagonist Anakinra sowie das Fusionsprotein Rilonacept und der Antikörper Canakinumab. Die beiden Letzteren sind neue Substanzen, die zur Behandlung der sehr seltenen Erkrankung CAPS zugelassen sind, berichtete die Referentin.
Gegen Interleukin 6 richtet sich der humanisierte Antikörper Tocilizumab, der in der Behandlung der Rheumatoiden Arthritis eingesetzt wird. Der Wirkstoff bindet den IL-6-Rezeptor und blockiert diesen, wodurch die IL-6-Wirkung unterdrückt wird. Eine wichtige Rolle in der Immunabwehr und damit auch bei Autoimmunreaktionen spielen die Antikörper bildenden B-Zellen. Um die B-Zellkomponente auszuschalten wurde der Antikörper Rituximab entwickelt. Er richtet sich gegen das Oberflächenprotein CD20 und sorgt für eine Elimination der B-Zellen. Ursprünglich wurde es für die Therapie des Non-Hodgkin-Lymphoms entwickelt, es ist aber auch für Rheumatoide Arthritis zugelassen und bewirkt eine massive Immunsuppression.
Ein weiterer Wirkstoff richtet sich gegen die Antigen-Erkennung der T-Zellen. Das Fusionsprotein Abatacept verhindert den Kontakt von antigenpräsentierenden Zellen und T-Zellen, sodass die Aktivierung der T-Zellen unterbleibt. Ebenfalls an der Antigen-Erkennung greift das Molekül Glatirameracetat an. Dabei handelt es sich um ein Peptidgemisch, das zufällig aus den Aminosäuren Lysin, Alanin, Glutaminsäure und Tyrosin zusammengesetzt ist und dadurch offensichtlich dem Hauptbestandteil der Myelinschicht um Axone ähnelt. Es wird in der Behandlung von Multipler Sklerose eingesetzt, um autoreaktive Moleküle abzufangen. Auf einer frühen Stufe des Immungeschehens setzt auch der Antikörper Natalizumab an. Er blockiert das Adhäsionsmolekül α4-Integrin auf den Endothelzellen der Blutgefäße und verhindert, dass Immunzellen aus dem Blutsystem in das Gewebe einwandern können.
Einen ersten Ansatz gegen die Autoimmunreaktion bei Typ-1-Diabetes stellt ein Antikörper gegen das Epitop CD3 auf T-Zellen dar. Dieser führt zu einer Depletion der cytotoxischen T-Zellen, die die Beta-Zellen des Pankreas angreifen.