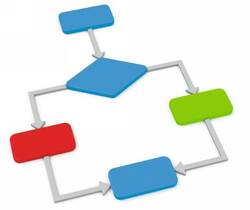Werden Breitspektrum-Antibiotika insbesondere im ambulanten Bereich übermäßig häufig verordnet, sei die Berücksichtigung von Leitlinien als Handlungskorridor, von denen in begründeten Fällen abgewichen werden könne und oft sogar müsse, unumgänglich.
Evidenz sollte entscheiden
Als »Königsklasse« der Leitlinien hob Fellhauer die Bedeutung von S3-Leitlinien hervor. Die grundsätzliche Kenntnis der Entwicklungsmethodik und Klassifizierung von Leitlinien (S1 bis S3), aber auch der darin verwendeten Evidenzklassen (Ia bis IV) sei unumgänglich. Ia steht für Evidenz aus Metaanalysen randomisierter kontrollierter Studien, IV für Evidenz aufgrund von Berichten/Meinungen von Expertenkreisen, Konsensus-Konferenzen und/oder klinischer Erfahrungen anerkannter Autoritäten.
Als Erkrankungen, die in der täglichen Praxis in aller Regel mit oral anzuwendenden Antibiotika behandelt werden, nannte er beispielhaft unkomplizierte Harnwegsinfekte, Infekte der oberen und tiefen Atemwege, HNO- sowie gastrointestinale Infektionen. Detailliert beschrieb der Pharmazeut die Ausgangssituation der akuten unkomplizierten Zystitis, die mit einer Resistenzrate von mehr als 20 Prozent bei E. coli gegenüber Cotrimoxazol einhergeht. Hier liege eine gute Studienlage für Nitrofurantoin vor. Die Behandlung mit diesem Wirkstoff gehe nur sehr selten mit schweren Nebenwirkungen wie hämolytischer Anämie, Lungenfibrose oder einer Braunfärbung des Urins einher. Sie werde daher in internationalen Leitlinien bereits empfohlen. Bei Patienten mit Niereninsuffizienz ist der Wirkstoff allerdings kontraindiziert.
Geringe Resistenzraten seien bei Fosfomycin-Trometamol zu verzeichnen, das evdienzbasiert für die Einmalgabe bei der akuten unkomplizierten Zystitis der Frau geeignet sei. Fluorchinolone seien ebenfalls noch gut wirksam, doch bestehe die Gefahr von »Kollateralschäden« durch Selektion resistenter Erreger. Wenig Evidenz, so Fellhauer, gebe es für die wirksame Anwendung von Amoxicillin/Clavulansäure und Oralcephalosporinen bei der Kurzzeittherapie von Harnwegsinfekten.
Unbedingt müssten Apotheker nicht nur die Leitlinienempfehlungen zu Harnwegs-, sondern auch zu Atemwegsinfektionen kennen. Dazu müssten sie wissen, welche Quellen zur Beschaffung aktueller Leitlinien zur Verfügung stehen. Internationale Bedeutung hätten besonders die Leitlinien der Infectious Diseases Society of America (http://www.idsociety.org). In Deutschland seien es unter anderem die Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (www.awmf.org), der Bundesärztekammer/Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Paul-Ehrlich-Gesellschaft (www.p-e-g.de), die auch spezielle Empfehlungen zur oralen Antibiotikatherapie herausgeben. Leitlinien-Charakter hätten zudem die systematischen Reviews der Cochrane-Collaboration. Damit sind Apotheker auch für den Apothekenalltag gut gerüstet.
Nachfragen ist Pflicht
Stellt der Patient in der Apotheke die Frage »Was halten Sie von diesem Antibiotikum?«, so müsse der Apotheker zunächst immer zurückfragen, gegen welche Infektion das Antibiotikum gerichtet ist und ob Besonderheiten wie Allergien, Schwangerschaft oder gestörte Nierenfunktion zu beachten seien. Nach der genauen Medikamenten-Anamnese, bei der unter anderem Fragen zur Vorbehandlung oder einer möglichen Sequenztherapie zu stellen sind, müssen Verordnungen mit der entsprechenden Leitlinie abgeglichen und mögliche Gründe, die für ein Abweichen von der Leitlinie sprechen, ausgeschlossen werden. Erst dann könne die detaillierte Beratung mit Einnahmehinweisen und Erläuterungen zur Therapiedauer, zu möglichen Nebenwirkungen, zur Compliance und vieles mehr erfolgen.
Einnahmehinweise seien essenziell, besonders bei Wirkstoffen mit geringer Bioverfügbarkeit, betonte der Referent. Der Patient trage hohe Mitverantwortung für den Therapieerfolg. Berichteten Patienten in der ärztlichen Anamnese über eine Penicillinallergie, so sei stets eine allergologische Stufendiagnostik erforderlich. 10 Prozent der Patienten nennen eine solche Unverträglichkeit. Sie kommt allerdings seltener vor als gemeinhin angenommen. Bei »echter« Penicillinallergie seien Cephalosporine der dritten Generation eine sichere Alternative.