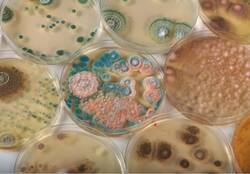Der menschliche Organismus und seine Bakterienflora hätten sich vielmehr über Millionen Jahre zusammen entwickelt. Das Ergebnis dieser Koevolution sei eine komplexe Gemeinschaft vieler Spezies, die Bosch als Metaorganismus bezeichnete.
Organisator Immunsystem
In dieser Lebensgemeinschaft bestehe die Aufgabe des Immunsystems nicht darin, Krankheiten abzuwehren, sondern »den Metaorganismus zu orchestrieren«. Denn wenn dieser aus dem Gleichgewicht gerät, sind komplexe Erkrankungen die Folge. Bosch belegte diese These damit, dass zwar die Inzidenzen von Infektionserkrankungen seit Jahren sinken, die Häufigkeit von Autoimmunerkrankungen wie Typ-1-Diabetes, Asthma und Morbus Crohn jedoch im selben Zeitraum dramatisch gestiegen ist.
Dem Referenten zufolge bestimmt der Wirt selbst, mit welchen Mikroben er langfristig zusammenlebt. Daher habe Homo sapiens genauso wie jede andere Tierart eine typische Bakterienzusammensetzung, die ihn als Spezies kennzeichnet. Der Wirt kommuniziere dabei mit seinen bakteriellen Bewohnern über antimikrobielle Peptide.
Die Selektion einzelner Mikroorganismen sei für den Organismus sogar so wichtig, dass die eigene Entwicklung davon abhänge. So fände bei einigen Fischarten die Ausdifferenzierung des Darms ohne bestimmte Bakterien nicht statt. Und: »Mäuse, die keimfrei aufgezogen werden, sind aggressiver als ihre Artgenossen, die unter normalen Bedingungen groß werden. Außerdem fehlt ihnen ein bestimmtes Gen, das für die neuronale Entwicklung wichtig ist«, erklärte Bosch.
Dass auch Krankheiten, die bisher nicht mit den uns besiedelnden Mikroorganismen in Zusammenhang gebracht wurden, durchaus davon abhängen könnten, zeigte Bosch am Beispiel der Adipositas. Das Gros der mehr als 500 verschiedenen Bakterienspezies im menschlichen Darm gehöre einer von zwei Gruppen an: den Firmicutes oder den Bacteroidetes. »Firmicutes können praktisch aus nichts Kalorien machen«, erklärte Bosch. Für den Organismus, der diese Bakterien beherberge, habe das erhebliche Konsequenzen.
So habe ein Experiment mit Mäusen gezeigt, dass sich die Anlage zur Fettleibigkeit durch die Transplantation der Darmbakterien von Tier zu Tier übertragen lässt. Mäuse, die zuvor normalgewichtig waren, entwickelten in dem Versuch eine Adipositas, nachdem ihre eigene Darmflora durch die einer fettleibigen Maus ersetzt worden war. Auch beim Menschen sei die Zusammensetzung der bakteriellen Lebensgemeinschaft im Darm bei Adipösen zugunsten der Firmicutes verschoben. »Die gezielte Manipulation der Darmflora könnte also ein neuer therapeutischer Ansatz zur Behandlung der Adipositas sein«, so Bosch. Derselbe Mechanismus, allerdings in umgekehrter Richtung, sei vermutlich der Grund, warum niedrig dosierte Antibiotika im Futter von Masttieren zu einer Gewichtszunahme führen.
Auch Viren gehören dazu
Doch wie kam es dazu, dass jede Spezies ihre eigene, einzigartige Bakterienbesiedelung entwickelte? »Ich glaube, dass dafür Viren verantwortlich sind. Denn in dem großen Metaorganismus spielen auch Viren mit«, so Bosch. Viren seien ebenso Wirt-spezifisch wie Bakterien. Das habe sein Mitarbeiter Dr. Juris Grasis gerade erst in einer noch nicht veröffentlichten Studie zeigen können. Ein Beleg für die enge Interaktion zwischen Viren und Bakterien sei die Tatsache, dass in dem von Grasis studierten Süßwasserpolypen Hydra 80 Prozent der Viren Phagen seien, also Bakterioviren.