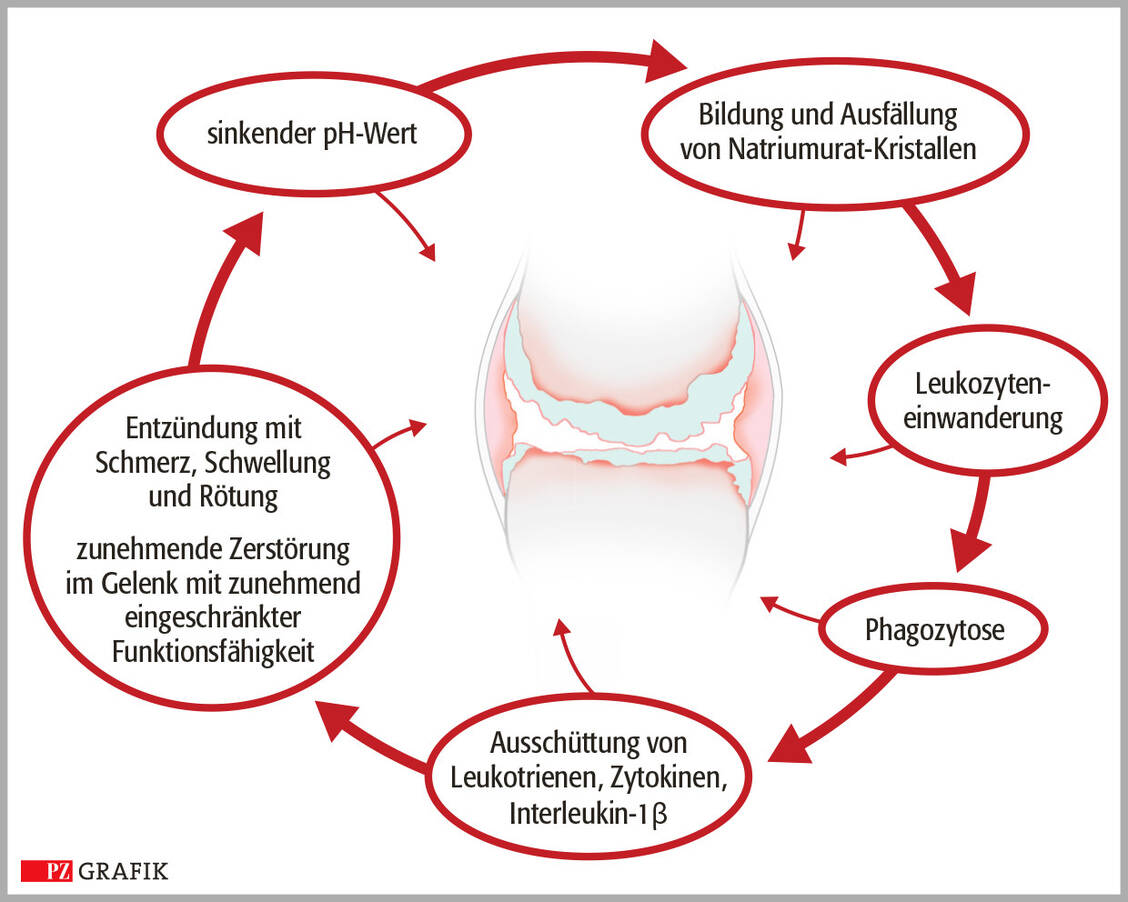Gicht wird überwiegend als Krankheit älterer Menschen wahrgenommen, doch es erkranken auch Kinder und Jugendliche. Die Störung des Harnsäurestoffwechsels mit erhöhten Harnsäurewerten ist bedingt durch Übergewicht, verursacht von Fehlernährung, übermäßigem Konsum von Fructose-haltigen Softdrinks und mangelnder Bewegung.
Bei der seltenen Stoffwechselerkrankung Lesch-Nyhan-Syndrom (Hyperurikose oder Hyperurikämie-Syndrom) fehlt genetisch bedingt das Enzym Hypoxanthin-Guanin-Phosphoribosyl-Transferase (HGPRT). Es sind überwiegend Jungen betroffen, da der Enzymdefekt über das X-Chromosom vererbt wird. Beim Neugeborenen fallen keine Symptome auf. Im Alter von sechs bis acht Wochen müssen sich betroffene Säuglinge auffällig oft übergeben, mit zehn Monaten fällt die Einschränkung der Beweglichkeit auf. Das Kind ist geistig weniger aktiv.
Es gibt unterschiedliche Ausprägungen des Lesch-Nyhan-Syndroms. In leichten Fällen (Kelley-Seegmiller-Syndrom) kommt es zu Nierensteinen und Gichtanfällen erst im Erwachsenenalter. In schweren Fällen zeigen sich im Kindesalter Entwicklungsstörungen, Selbstverletzungen, Krämpfe und Störungen des Muskeltonus bis zum Tod. Die Krankheit ist nicht heilbar. Behandelt wird mit Allopurinol und diätetischen Maßnahmen.