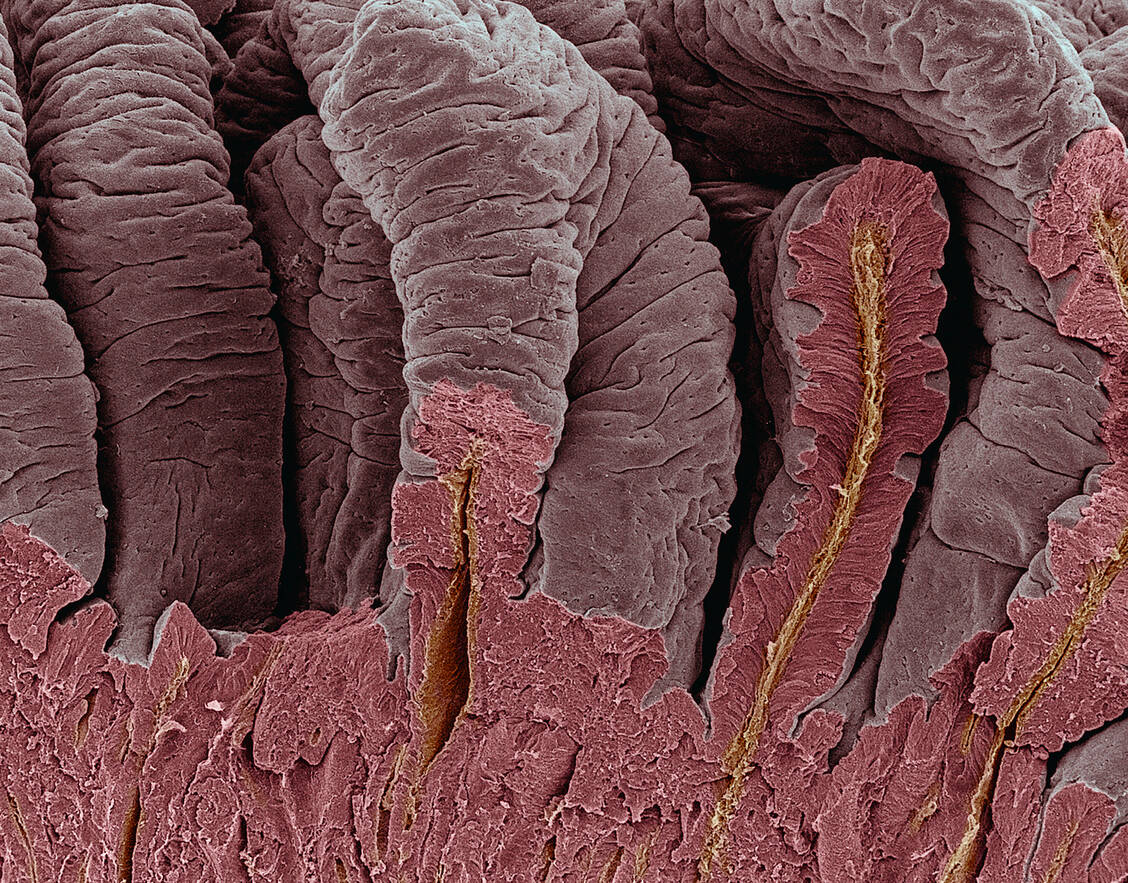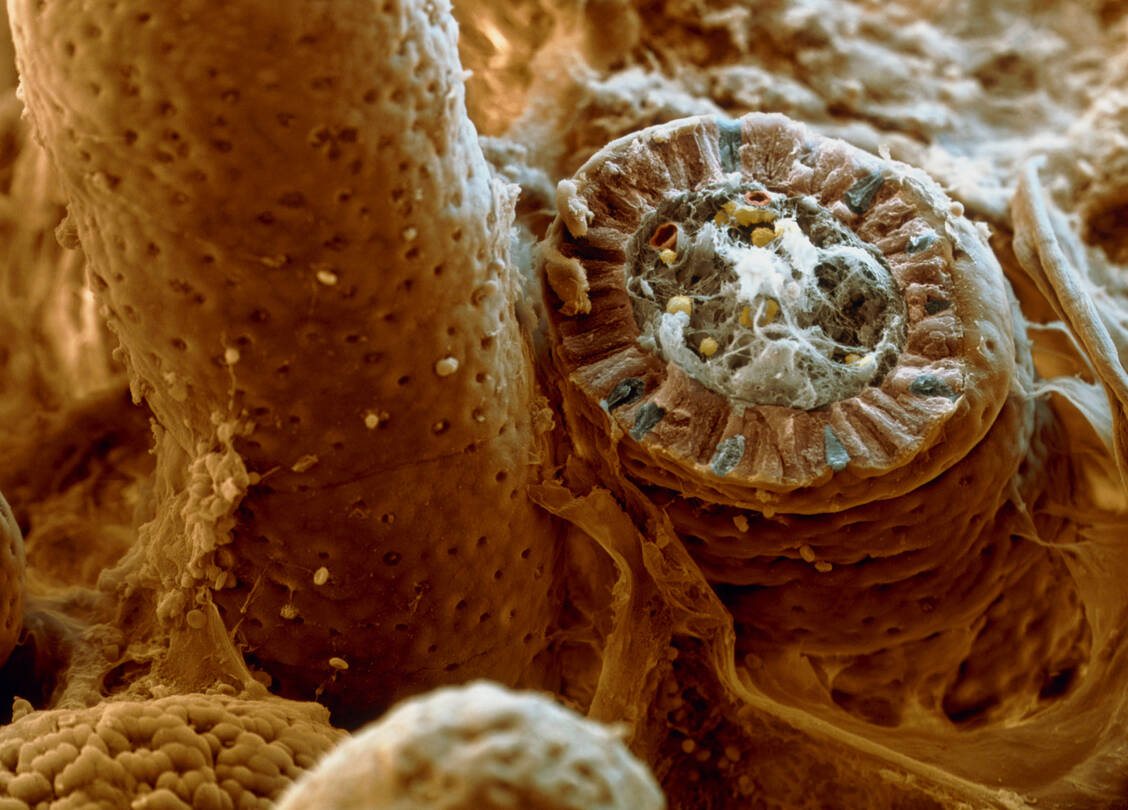Privat beauftragte Mikrobiomanalysen per Stuhltests seien zu oberflächlich und nicht zweifelsfrei interpretierbar. Deshalb rät die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) von kommerziellen Mikrobiomtests ohne ärztliche Beratung ab.
Ein aktuell in »Science« publiziertes Paper belegt: Viele der von den Unternehmen behaupteten Fähigkeiten, von der Norm abweichende Mikrobiome erkennen zu können, sind nicht durch Forschungsergebnisse gestützt. Vor dem Hintergrund, dass »derzeit keine Einigkeit darüber besteht, was eine gesunde Zusammensetzung des menschlichen Mikrobioms in einer Bevölkerung oder Bevölkerungsgruppe ausmacht«, sei mit den Tests eine kommerzielle Ausnutzung von Verbrauchern zu befürchten, schreibt die US-amerikanische Forschungsgruppe. In der Tat: Bei ihren Recherchen fanden die Wissenschaftler weltweit 31 kommerzielle Anbieter, von denen rund die Hälfte eigene Nahrungsergänzungsmittel aufgrund ihrer Testergebnisse empfehlen.
Um Verbraucher vor Schaden durch irreführende Testergebnisse zu schützen, sollten Regulierungsbehörden Anforderungen entwickeln, um die Konsistenz und Validität von Methoden und Behauptungen zu dokumentieren und nachzuweisen. Die Studie empfiehlt, dass Unternehmen ihre Testmethoden offenlegen und die analytische Gültigkeit ihrer Tests nachweisen müssen.