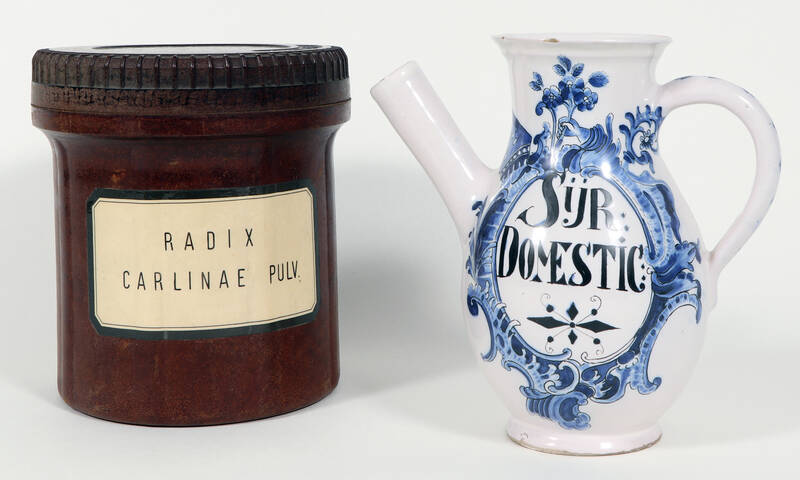Lange suchte das Museum nach diesem kompakt designten Technikdenkmal. Der direkte Kontakt zu CGM Lauer, Fürth, führte schließlich zum Ziel. Bei einem Besuch der Museumsdirektorin Dr. Elisabeth Huwer am Firmenstandort in Fürth im März 2023 wurde ein »Lauer Frosch« als Schenkung an das Deutsche Apotheken-Museum übergeben (Inv.-Nr. III S 14, Abbildung 4).
Mit 8 Bit stellt er ein Übergangsmodell zum Nachfolger mit 16 Bit dar und wurde in der Firma als sogenannte »Mutter« verwendet. Von diesem Gerät aus wurden die auszuliefernden Lauer-Frösche mit aktuellen Daten bestückt. Ausgestattet mit einem 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk für 512 KB steht es auch für die angebrochene neue Ära der Datenspeicherung auf kleinen Disketten. Mit einem Leseschlitz am Bildschirmrand ist die Nutzung der ABDA-Lochkärtchen weiterhin möglich.