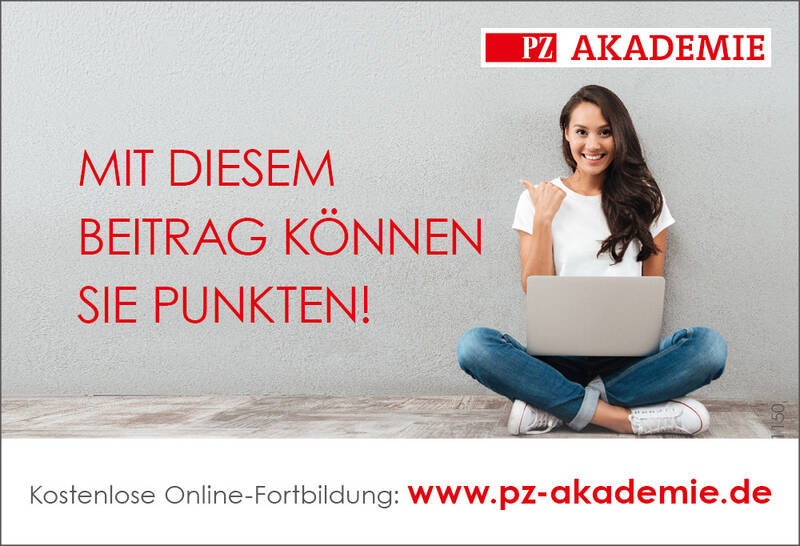Influenza und COVID können in der Spätschwangerschaft relativ schwer verlaufen. Die Therapie erfolgt rein symptomatisch. Die Influenza-Impfung wird klar im zweiten oder dritten Trimenon empfohlen. Im ersten Trimenon empfiehlt man sie eher Frauen, die per se ein erhöhtes Krankheitsrisiko für Influenza tragen (chronische Erkrankungen). Die Corona-Impfung wird ebenfalls allen Schwangeren im zweiten und dritten Trimenon empfohlen.
Impfungen gegen Hepatitis A und B, auch die Grundimmunisierung, sind möglich.
Um einen bestmöglichen Schutz des Neugeborenen vor Keuchhusten (Pertussis) zu erreichen, wird diese Impfung jeder Schwangeren empfohlen, idealerweise in der 27. bis 36. Schwangerschaftswoche. Die Verabreichung erfolgt als Drei- oder Vierfachimpfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten sowie gegebenenfalls zusätzlich gegen Kinderlähmung.