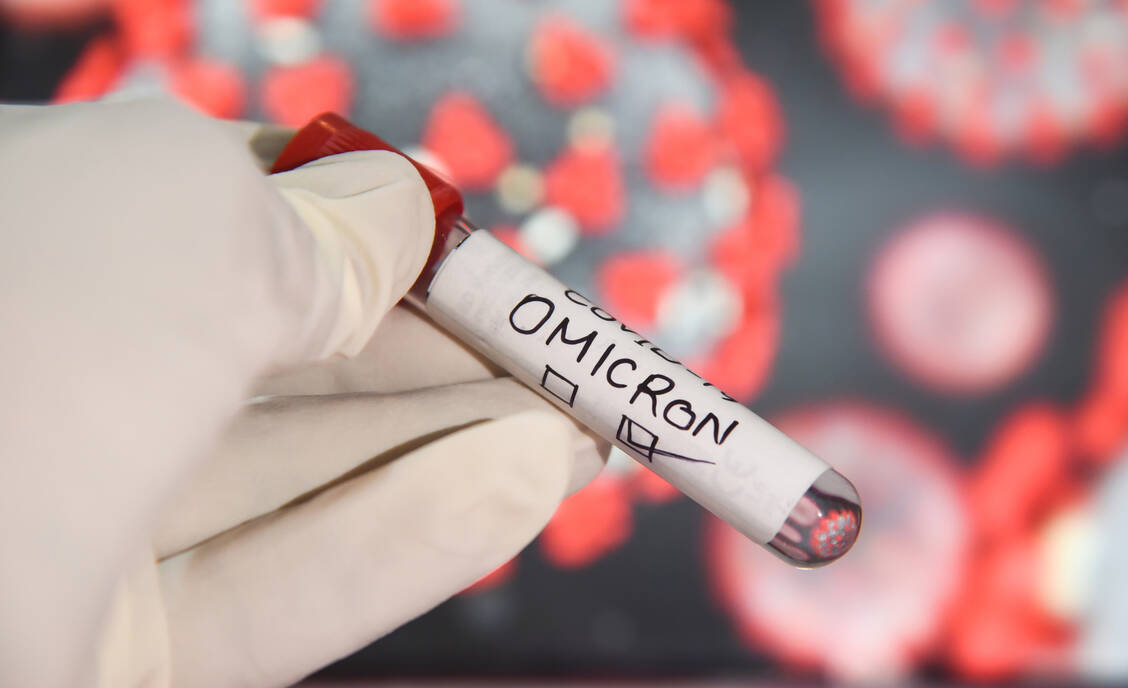Allerdings weisen die Autoren auf ein Caveat zu ihrer Studie hin, da die von ihnen ermittelten Ergebnisse bei hospitalisierten Patienten erhoben wurden, die zum Zeitpunkt der Serumspende höchstwahrscheinlich hohe Konzentrationen an infizierten Zellen und Antigen aufwiesen, die eine wirksame Primärreaktion auf Omikron induzierten. Sie erachten es daher als unwahrscheinlich, dass eine einmalige Immunisierung mit einem Omikron-Impfstoff ähnlich wirksam sein wird und spekulieren, dass als Konsequenz wohl zwei Impfungen erforderlich sein könnten, um ausreichend naive B-Zellen zu aktivieren. Außerdem stellen sie die Frage, ob es sinnvoll ist, dass angepasste Impfstoffe auch ein Antigen des ursprünglichen WA1-Stamms enthalten sollten.