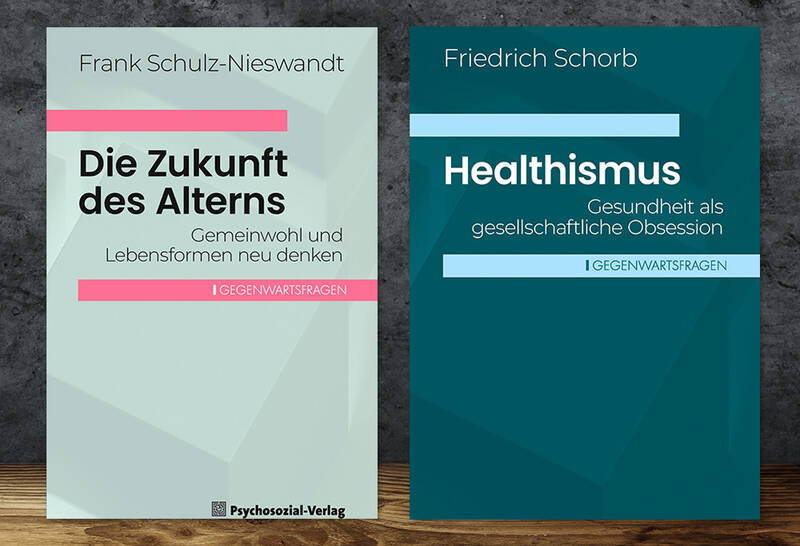Die beiden Stellschrauben für eine höhere Lebenserwartung sind: infrastrukturelle Maßnahmen, die auf die gesamte Gesellschaft wirken, und Gesundheitsvorsorge, die jeder Einzelne durch sein Verhalten beeinflussen kann. So hat beispielsweise die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser, die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten sowie die Schaffung von stabilen politischen Rahmenbedingungen einen hohen Effekt auf alle. Zusätzlich kann jeder Mensch durch Prävention sein individuelles Krankheitsrisiko minimieren.
Nach Ansicht von Schorb ist in der jüngsten Vergangenheit allerdings eine Schieflage entstanden, die nun deutlich mehr Verantwortung von jedem Einzelnen erwartet. Er macht das am Beispiel Übergewicht deutlich. Vielen sei gar nicht bewusst, wie sehr übergewichtige Menschen stigmatisiert und diskriminiert würden. Das hinge damit zusammen, dass Übergewicht nicht als »unveränderliches Schicksal« wahrgenommen werde, sondern als Folge von »mangelnder Disziplin«.
Dagegen werde eine Benachteiligung aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft oder sexueller Orientierung gemeinhin als ungerecht empfunden. Das negative Einstellung beim Thema Übergewicht wird laut Schorb damit gerechtfertigt, dass Betroffene sich einfach mehr anstrengen müssen. Eine Ungleichbehandlung sei gesellschaftlich sogar gewollt, damit Menschen motiviert blieben. Es handele sich um eine moralische Wertung, die weit mehr verbreitet ist als nur beim Übergewicht.