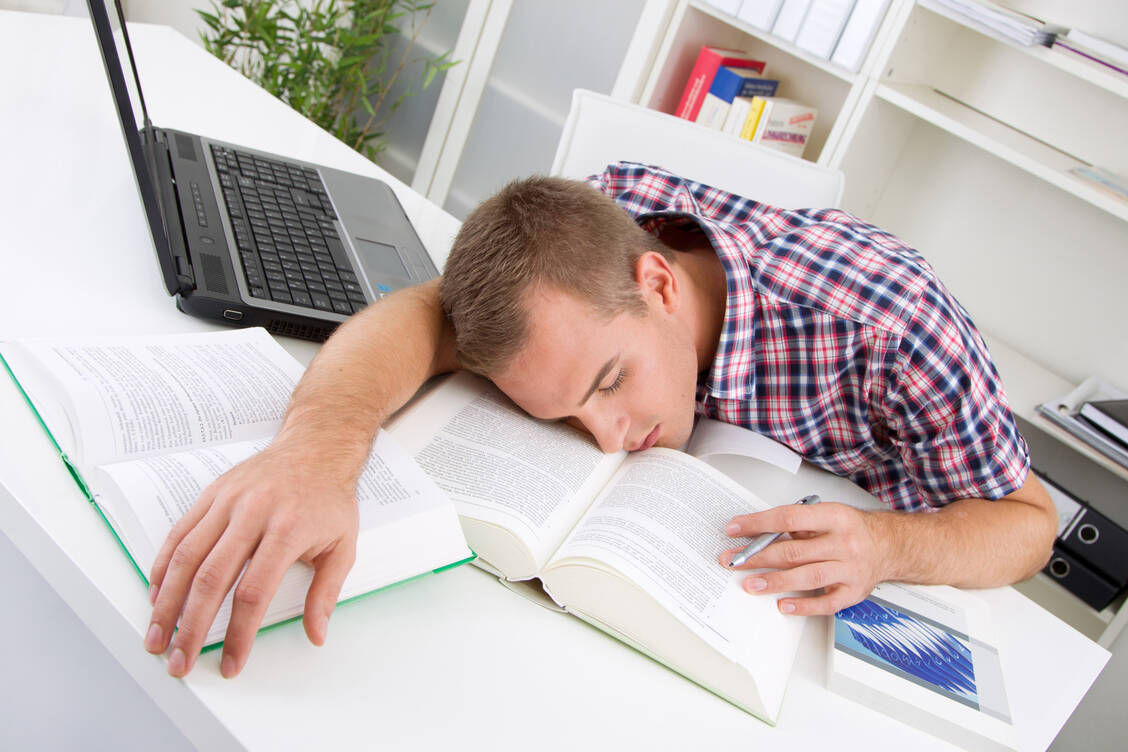Die erhöhte Erschöpfbarkeit ist ein häufiges, stark einschränkendes Symptom bei Multipler Sklerose (MS). So treten kognitive Störungen und Fatigue-Beschwerden bereits frühzeitig im Krankheitsverlauf auf. Im weiteren Verlauf ist die körperliche und/oder geistige Leistungsfähigkeit derart eingeschränkt, dass die Patienten alltägliche Anforderungen nur noch schwer bewältigen können.
Die Ursachen der MS-bedingten Müdigkeit sind weitgehend ungeklärt, aber wahrscheinlich multifaktoriell bedingt (6). So bestehen Zusammenhänge zu Schädigungen des motorischen Cortex und der Basalganglien, aber auch zu immunologischen Parametern. Diese lassen sich bei der immunvermittelten, chronisch-entzündlichen Erkrankung des Zentralnervensystems mit unterschiedlicher Ausprägung zur Demyelinisierung (Entmarkung) und der damit verbundenen Zerstörung der Axone finden.
Ein Typ-2-Diabetes verläuft möglicherweise über Jahre hinweg unbemerkt, da kein subjektives Krankheitsgefühl besteht. Betroffene verspüren erste Beschwerden, darunter leichte Müdigkeit, Abnahme der Konzentrationsfähigkeit und Rückgang der körperlichen Leistungsfähigkeit erst bei immer wieder sehr hohen Plasmaglucosewerten von über 250 mg/dl oder einem HbA1c-Wert von 9,5 Prozent. Die Ursachen für die Fatigue-Symptome liegen im insgesamt instabilen Glucosestoffwechsel mit täglichen Schwankungen des Blutzuckerspiegels. Dessen Abfall führt zu Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Verwirrtheit und Schwindelgefühl.