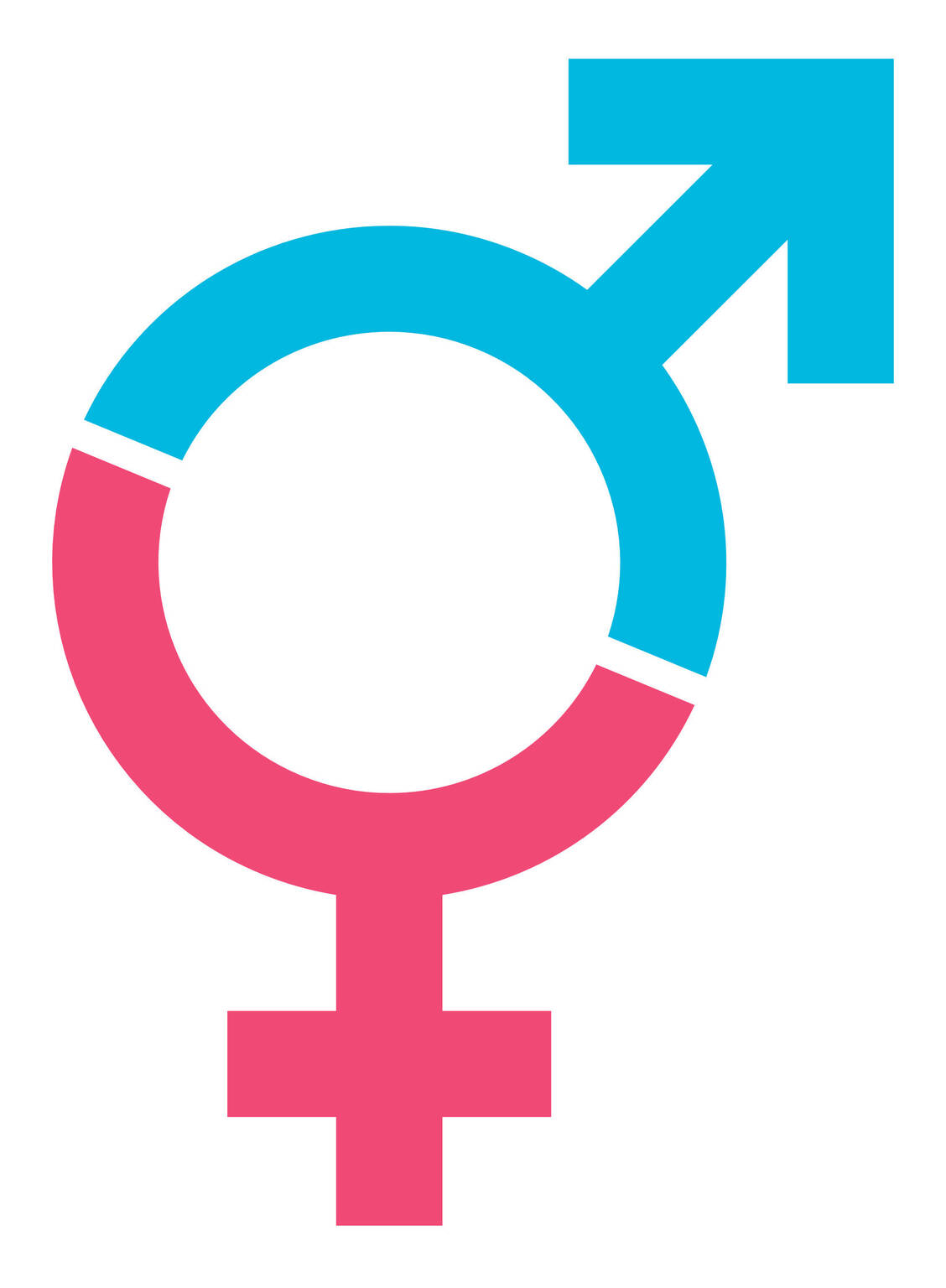Wenn es um genetische Unterschiede bei Männern und Frauen geht, ist in der Regel von den X- und Y-Chromosomen die Rede. Frauen haben zwei X-Chromosomen, Männer ein X- und ein Y-Chromosom. Viele Gene, die das Immunsystem regulieren, liegen ausschließlich auf dem X-Chromosom. Der alte Glaube, dass das zweite X-Chromosom bei Frauen komplett inaktiv ist, ist mittlerweile widerlegt. Heute weiß man, dass Immunzellen bei Frauen Gene auf beiden X-Chromosomen ablesen können. Dadurch steht ihnen ein vielfältigeres Spektrum an Abwehrmechanismen zur Verfügung, was die effektivere Reaktion des weiblichen Immunsystems erklären könnte. Zudem kann bei Frauen der Ausfall von einem Gen auf einem der beiden X-Chromosomen kompensiert werden, indem die Information vom anderen herangezogen wird.