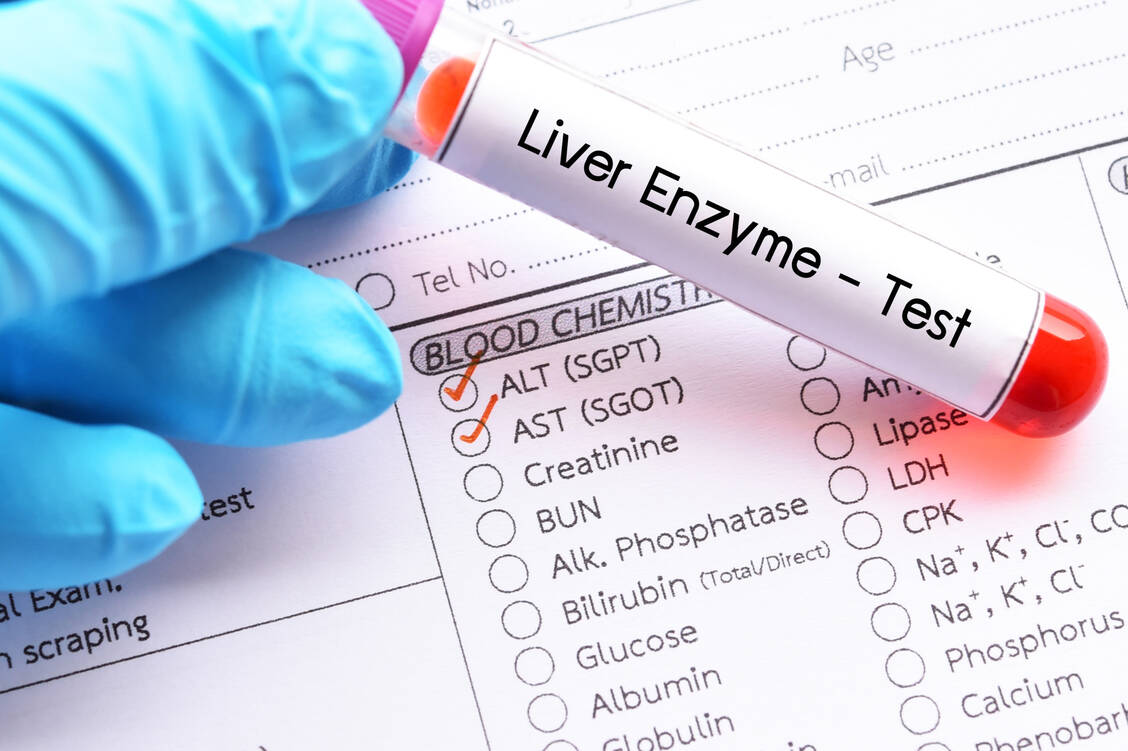Zu den häufigsten Nebenwirkungen mit Schweregrad 3 oder 4 unter Tucatinib gehören Diarrhö und erhöhte Leberenzymwerte. Fast 30 Prozent der Patienten erlitten schwerwiegende Nebenwirkungen wie Diarrhö, Erbrechen und Übelkeit. Bei 6 Prozent der Patienten führten Nebenwirkungen zum Therapieabbruch, meist Diarrhö und erhöhte ALT-Werte. 23 Prozent der Patienten erlitten Nebenwirkungen, die zu einer Dosisreduktion führten.
Neben den genannten Nebenwirkungen kommt es zudem sehr häufig zu Nasenbluten, Stomatitis, Ausschlag, Arthralgie, erhöhten Konzentrationen von Bilirubin und Gewichtsabnahme.
Tucatinib darf bei schwangeren Frauen nicht angewendet werden, es sei denn, dass der klinische Zustand der Frau dies erfordert. In Tierexperimenten wurde eine Reproduktionstoxizität gezeigt. Frauen im gebärfähigen Alter sollten vor Therapiebeginn auf eine Schwangerschaft getestet werden. Die Frau sollte während der Behandlung mit dem neuen TKI nicht stillen.