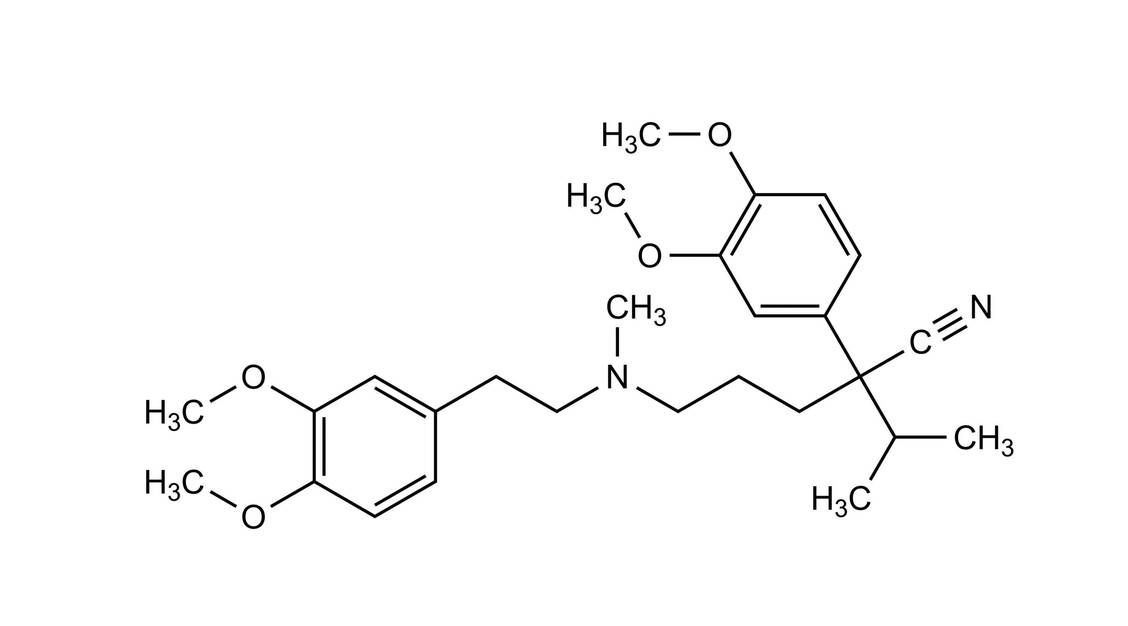Verapamil wird über die CYP-Enzyme 3A4, 1A2, 2C8, 2C9 und 2C18 metabolisiert. Außerdem hemmt der Wirkstoff CYP3A4 und P-Glycoprotein (P-gp). Die Liste potenzieller Wechselwirkungspartner ist deshalb lang und muss patientenindividuell Wirkstoff für Wirkstoff durchgegangen werden.
In der Praxis besonders bedeutsam dürften eine erhöhte Blutungsneigung bei gleichzeitiger Anwendung von Verapamil mit Acetylsalicylsäure (ASS) sowie ein erhöhtes Risiko für eine Rhabdomyolyse bei gleichzeitiger Anwendung mit hoch dosiertem Simvastatin sein. Bei Statinen wie Fluvastatin, Pravastatin und Rosuvastatin, die nicht über CYP3A4 verstoffwechselt werden, ist eine Interaktion mit Verapamil weniger wahrscheinlich.
Die gleichzeitige Anwendung von Verapamil mit dem Herzfrequenz-Senker Ivabradin ist kontraindiziert.
Auf den Verzehr von Grapefruit beziehungsweise Grapefruitsaft sollte unter der Therapie mit Verapamil verzichtet werden. Gleiches gilt für den Genuss von Alkohol, da der Wirkstoff den Abbau von Ethanol hemmt und dadurch dessen Wirkung verstärkt.