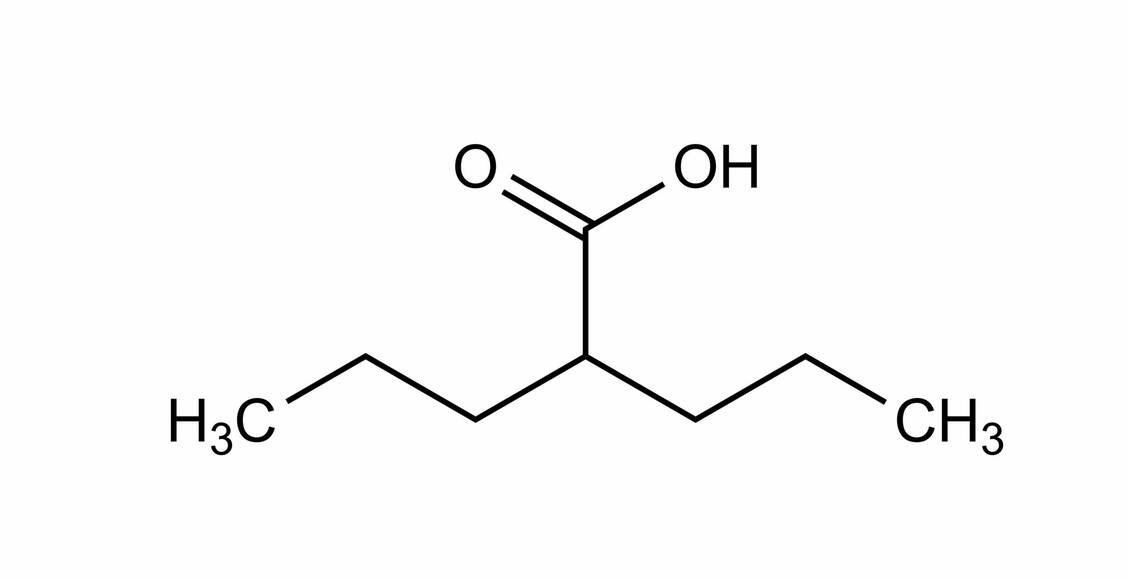Ein Absinken der Valproinsäure-Serumspiegel und damit eine verminderte Wirkung können ausgelöst werden durch enzyminduzierende Antiepileptika wie Phenobarbital, Primidon, Phenytoin und Carbamazepin sowie Mefloquin, Carbapeneme, Rifampicin und Protease-Inhibitoren wie Lopinavir oder Ritonavir. Der umgekehrte Effekt, also erhöhte Valproinsäure-Spiegel, wird beobachtet unter Erythromycin, Felbamat oder Acetylsalicylsäure.
Auch Valproinsäure selbst beeinflusst andere Arzneimittel. Klinisch besonders wichtig ist die Erhöhung der Phenobarbital-Konzentration, was zu einer starken Sedierung, besonders bei Kindern, führen kann. Ebenso kann die Menge von freiem Phenytoin steigen, ohne dass der Serumspiegel von Gesamt-Phenytoin steigt, was das Risiko für eine Hirnschädigung erhöht. Valproinsäure hemmt den Metabolismus von Lamotrigin und verdoppelt nahezu dessen Halbwertszeit.
Valproinsäure kann die zentraldämpfende Wirkung von Benzodiazepinen, Barbituraten, Antipsychotika, MAO-Hemmern und Antidepressiva verstärken. Bei gleichzeitiger Einnahme von Antikoagulanzien kann die Blutungsneigung ansteigen; daher werden regelmäßige Kontrollen der Blutgerinnung empfohlen.