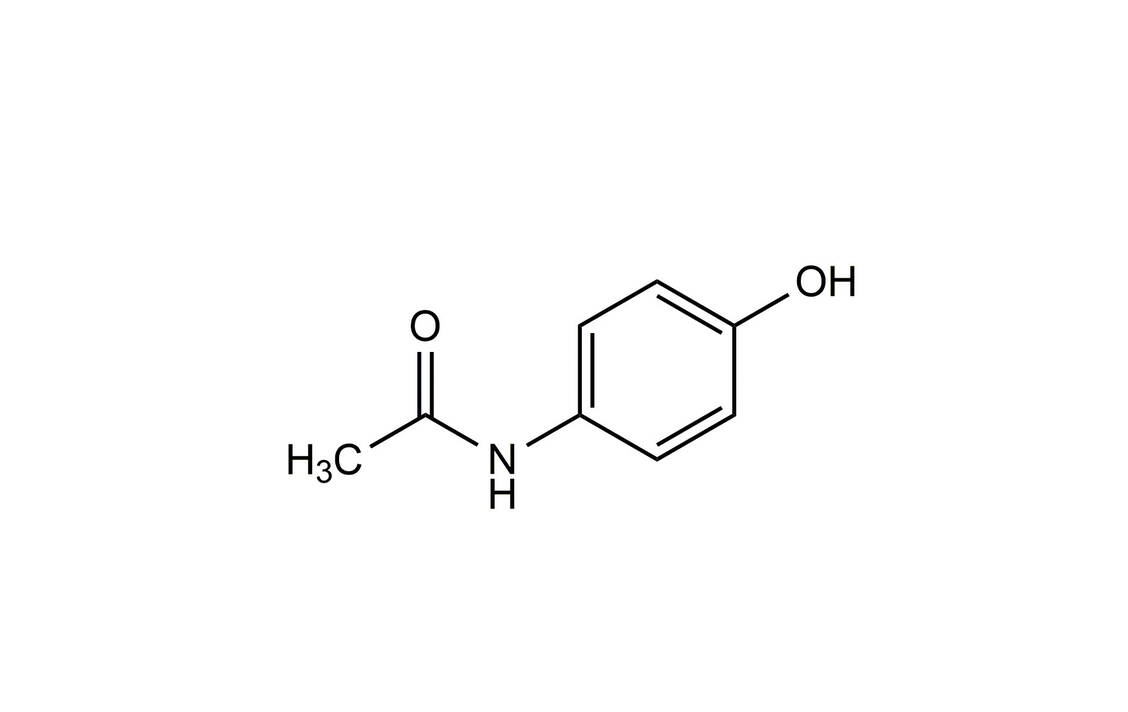Die Dosis richtet sich nach dem Körpergewicht und dem Alter des Patienten. In der Regel werden 10 bis 15 mg Paracetamol pro kg Körpergewicht als Einzeldosis gegeben; 60 mg pro kg Körpergewicht oder auch 4 g bei Erwachsenen gelten als Tageshöchstdosis. Die Einnahme erfolgt über den Tag verteilt, wobei ein Dosisintervall von mindestens sechs Stunden einzuhalten ist. Leber- und Niereninsuffizienz sowie unter anderem ein Körpergewicht unter 50 kg, chronischer Alkoholmissbrauch und Wasserentzug erfordern eine Dosisreduktion und/oder eine Verlängerung des Dosisintervalls. Insbesondere bei Kindern, deren Körpergewicht sich ja schnell verändert, lohnt sich vor jeder Behandlung erneut der Blick in die Dosistabellen im Beipackzettel, denn bei ihnen sind Über- und Unterdosierungen häufig.
Für die abgestufte Dosierung stehen neben Tabletten in verschiedenen Stärken auch diverse andere Darreichungsformen wie Brause- und Schmelztabletten, Zäpfchen, Lösungen, Tropfen, Granulat und eine Infusionslösung zur Verfügung. Ohne ärztliche Kontrolle sollte Paracetamol maximal drei Tage lang angewendet werden.