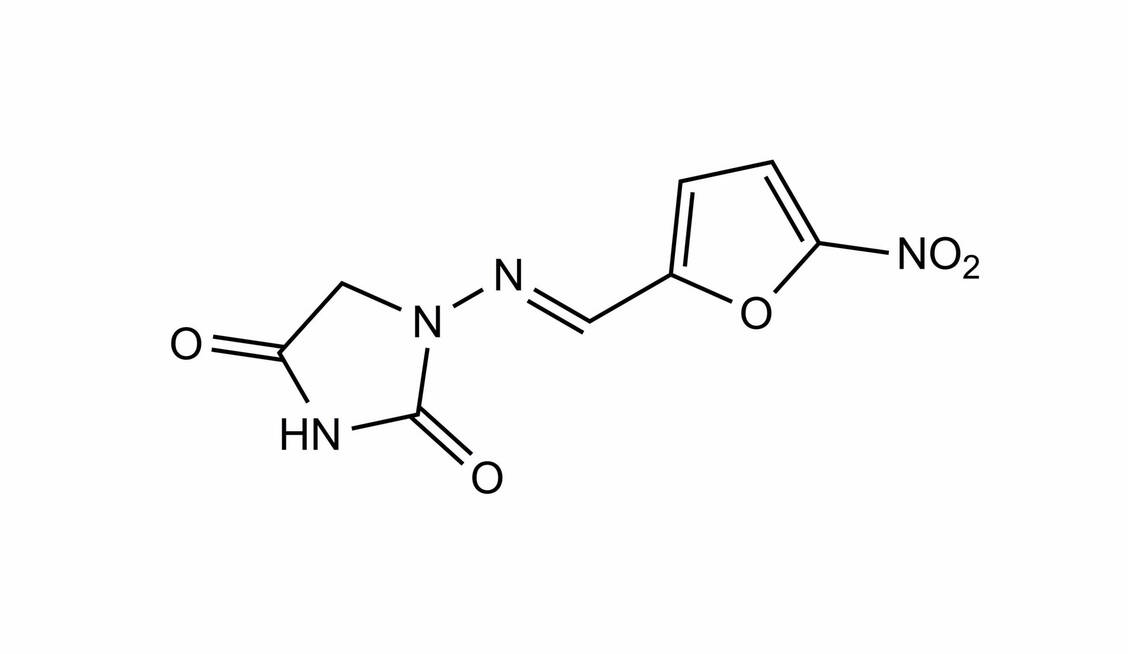Sehr häufige Nebenwirkungen sind Schwindel, Koordinationsstörungen (Ataxie) oder unkontrollierte, zuckende Augenbewegungen (Nystagmus). Das Reaktionsvermögen kann beeinträchtigt sein. Weiterhin treten häufig allergische Reaktionen wie Arzneimittelfieber, Juckreiz, Nesselsucht oder Schwellungen der Haut oder Schleimhaut (angioneurotisches Ödem) auf. Der Urin kann sich gelb bis braun verfärben; dies ist harmlos, sollte jedoch ärztlich abgeklärt werden. Besonders zu Therapiebeginn können Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen auftreten.
Lebensbedrohlich können Lungenreaktionen wie Flüssigkeitsansammlungen und Entzündungen sein. Treten Atemnot, Brustkorbschmerzen und Husten auf, muss der Patient die Behandlung sofort abbrechen und einen Arzt aufsuchen. Dasselbe gilt bei Symptomen eines anaphylaktischen Schocks oder einer schweren Leberschädigung (Gelbsucht, dunkler Urin, Hautjucken, Bauchschmerzen).