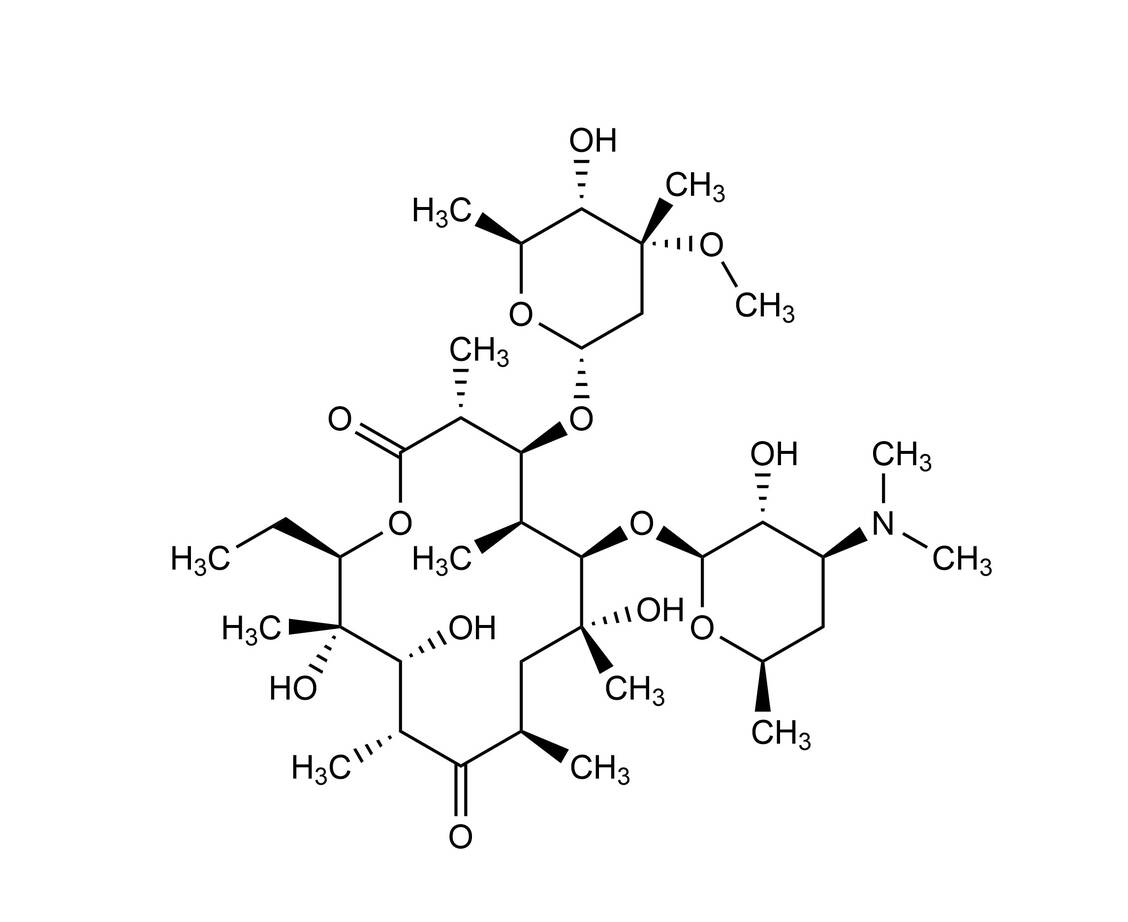Die Wechselwirkungen von Erythromycin mit anderen Arzneistoffen basieren hauptsächlich auf einer Beeinflussung des Metabolismus in der Leber, insbesondere auf einer Hemmung von CYP3A4. Hierdurch kommt es zu einer Verstärkung der Wirkung und Nebenwirkungen anderer durch CYP3A verstoffwechselten Arzneimittel. Gegebenenfalls sollte deren Konzentration im Blut kontrolliert und eine Dosisanpassung vorgenommen werden. Das gilt vor allem für Carbamazepin, Clozapin, Phenytoin oder Valproinsäure. Zudem gibt es Berichte über erhöhte gerinnungshemmende Wirkungen, wenn Erythromycin und orale Gerinnungshemmer wie Warfarin und Rivaroxaban gleichzeitig angewendet werden.
Die Kombination mit Simvastatin, Lovastatin oder Atorvastatin ist kontraindiziert. Auch bei anderen Statinen können Nebenwirkungen, insbesondere Myopathien, verstärkt werden.
Unter der Behandlung mit Makrolid-Antibiotika kann es zu einer Verlängerung des QT-Intervalls am Herzen kommen. Das kann zu Arrhythmien oder Torsade de Pointes führen. Erythromycin sollte bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit, schwerer Herzinsuffizienz, Reizleitungsstörungen oder klinisch relevanter Bradykardie mit Vorsicht angewendet werden. Gleiches gilt für Patienten, die gleichzeitig andere QT-Zeit-verlängernde Wirkstoffe erhalten. Arzneimittel, die das QT-Intervall signifikant verlängern, sind kontraindiziert.