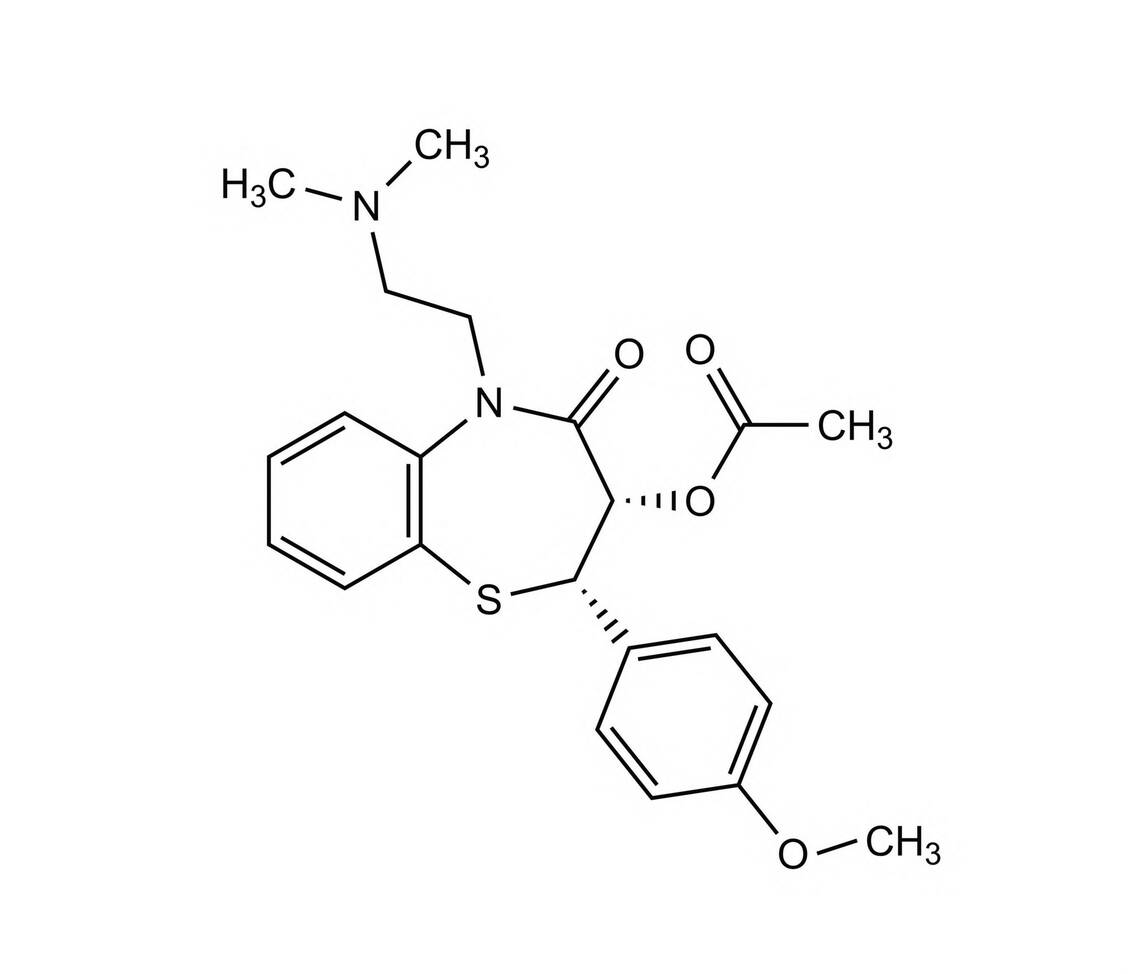Diltiazem wird über CYP3A4 metabolisiert und ist ein Inhibitor von CYP3A4. Die gleichzeitige Gabe mit Substraten dieses Enzyms, zum Beispiel Simvastatin, Lovastatin und Atorvastatin, Carbamazepin, Midazolam, Triazolam, Alfentanil, Theophyllin, Ciclosporin A und Herzglykoside, erfordert daher besondere Vorsicht und gegebenenfalls eine Dosisanpassung des Interaktionspartners. Bei gleichzeitiger Gabe von Rifampicin, Cimetidin oder Ranitidin kann sich der Plasmaspiegel von Diltiazem verändern; Patienten sollten aufmerksam überwacht werden.
Bei gleichzeitiger Anwendung von Diltiazem mit anderen Antihypertonika addieren sich die blutdrucksenkenden Effekte, sodass es zu einer Hypotonie kommen kann. Auch die vasodilatierende Wirkung von Nitratderivaten wird durch Diltiazem verstärkt. Dasselbe gilt für die (kardialen) Wirkungen verschiedener Anästhetika, weshalb Patienten, die Diltiazem anwenden, vor einer Vollnarkose den Anästhesisten darüber informieren müssen.
Diltiazem kann die Empfindlichkeit gegenüber Lithium verstärken.