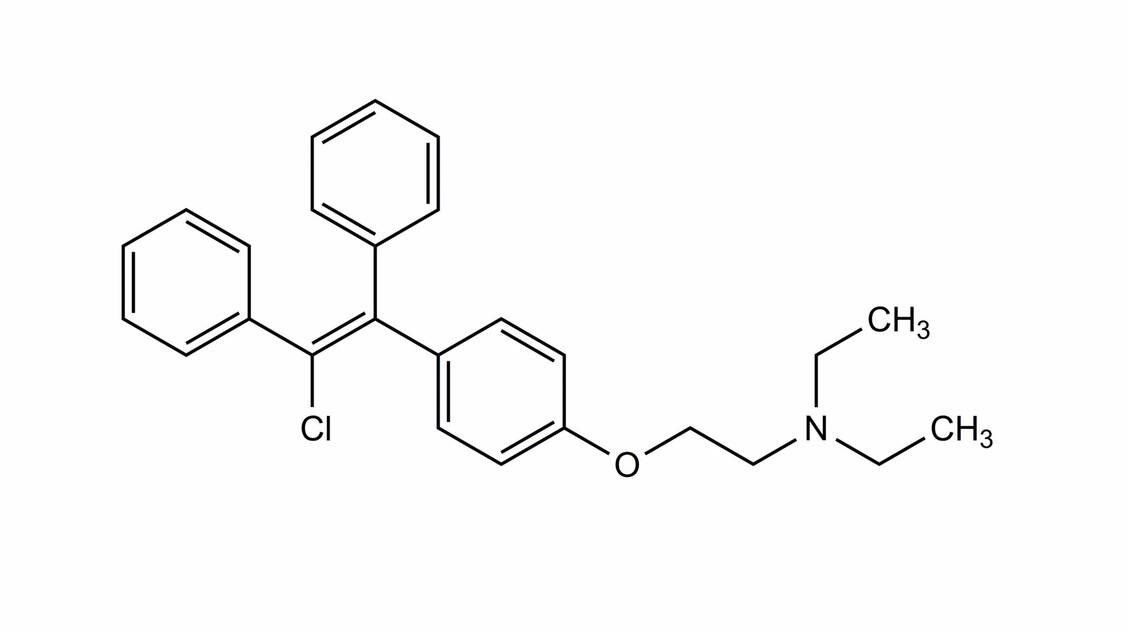Beginn und Dauer einer Therapie mit Clomifen sowie die Dosierung werden vom behandelnden Arzt festgelegt. Empfohlen wird eine Tablette à 50 mg Clomifen täglich über fünf Tage im ersten Behandlungszyklus mit Start um den fünften Zyklustag. Der erste Zyklustag ist der erste Tag der Regelblutung. Hat die Betroffene länger nicht menstruiert, kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt begonnen werden oder zunächst eine Regelblutung mit Gestagenen ausgelöst werden. Die Tablette soll unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit nach einer Mahlzeit eingenommen werden.
Die Frau sollte während der Behandlung und darüber hinaus täglich ihre vaginale Basaltemperatur messen und vom Arzt auf Anzeichen einer Ovulation untersucht werden. Per Ultraschall wird geprüft, ob (nur) ein Follikel herangereift ist. Dann gibt der Gynäkologe »grünes Licht« für Geschlechtsverkehr, der nun alle ein bis zwei Tage erfolgen sollte. Um den 30. Zyklustag herum kann ein Schwangerschaftstest gemacht werden.
Bleibt das gewünschte Ergebnis trotz nachweisbarer Follikelreifung aus, kann ein zweiter Behandlungszyklus mit der doppelten Dosis erfolgen. Mit der höheren Dosierung steigt das Risiko für Nebenwirkungen. Mehr als sechs Behandlungszyklen werden nicht empfohlen.