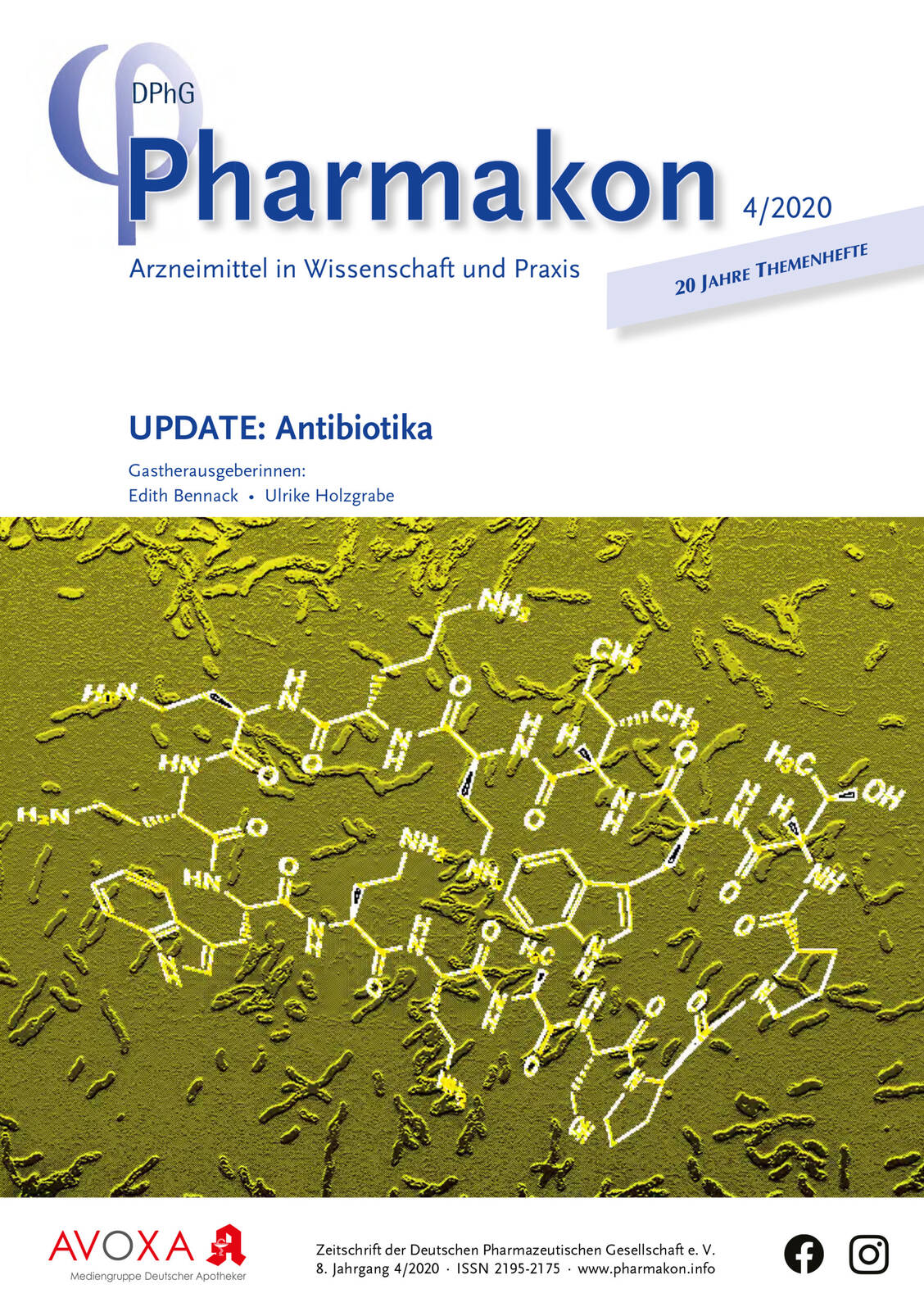Eine weitere UAW, die in den vergangenen Jahren zunehmende Beachtung erfahren habe, seien Störungen des peripheren Nervensystems. Periphere Neuropathien seien bei älteren Menschen an sich schon häufig, bedingt etwa durch Diabetes, falsche Ernährung, Alkohol, Arzneistoffe oder auch Infektionen. Wenn es sich um seltene Ereignisse handele, sei der Nachweis eines kausalen Zusammenhangs mit einem Medikament extrem schwierig, für die Fluorchinolone aber anhand der Auswertung der Daten von 1,4 Millionen Patienten in Großbritannien gezeigt worden. Da das Risiko mit der Behandlungsdauer steige, stellten möglichst kurze Behandlungszeiten offenbar eine Möglichkeit dar, die Schädigung peripherer Nerven zu vermeiden.