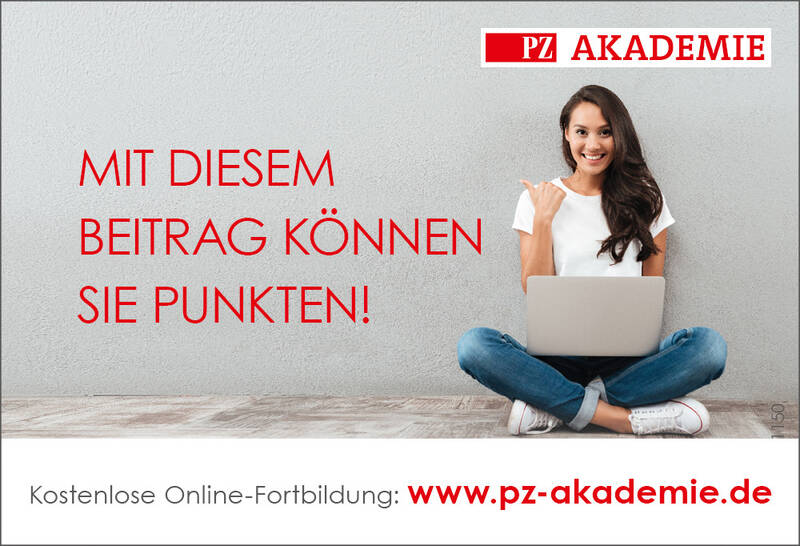Antikonvulsiva wie Gabapentin und Pregabalin sind bei chronisch neuropathischem Schmerz die Mittel der ersten Wahl (47, 50). Die häufigsten Nebenwirkungen sind Müdigkeit, Benommenheit und Gewichtsveränderungen. Zudem ist das Sturzrisiko erhöht, nicht jedoch eine Verschlechterung der Kognition (51). Carbamazepin sollte, außer bei Trigeminusneuralgie, wegen seines Risikos für Hyponatriämie und Interaktionen vermieden werden (52).
Wichtig für die Adhärenz ist, den Patienten zu erklären, dass »Schmerz wie ein epileptischer Anfall im Nerv« ist und daher ein Mittel gegen Epilepsie verordnet wird. Vor einer Kombination von Opioiden und Gabapentinoiden wird gewarnt, da das Risiko für Atemdepression und Stürze deutlich erhöht ist (37, 53). Weiterhin ist zu beachten, dass die Dosis der Koanalgetika bei reduzierter Nierenleistung angepasst werden muss.