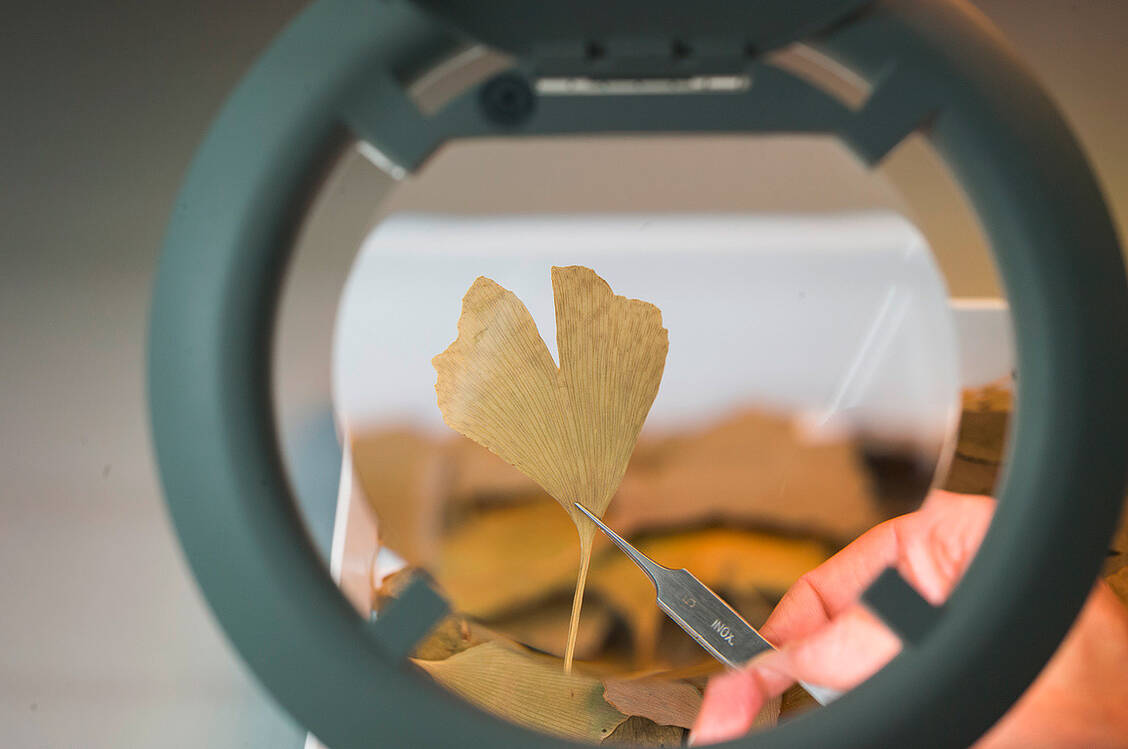Ist es dennoch prinzipiell möglich, ein zugelassenes Phytopharmakon zu kopieren? »Die Antwort lautet zum jetzigen Zeitpunkt Nein«, sagte Dingermann. Dem trage die Zulassungsbehörde Rechnung, indem das Original auf Basis einer Zulassung und die vermeintliche Kopie registriert im Markt seien. »Dies mag überraschen, da es bei gentechnisch hergestellten Medikamenten offensichtlich möglich ist, Kopien in Form der Biosimilars anzufertigen«, so Dingermann. Für Biologika wie für Phytopharmaka gelte das Paradigma »The Product is the Process«, was bedeute, dass das Produkt auf einem genau definierten Herstellungsprozess beruhe, der sich nicht kopieren lasse. Jedoch ließen sich gentechnisch hergestellte Moleküle heute sehr viel exakter analysieren und charakterisieren als noch vor wenigen Jahren. Dies gestatte es, einen alternativen, jedoch ebenfalls umfangreich spezifizierten Herstellungsprozess zu definieren, der zu einem äquivalenten Produkt führe.