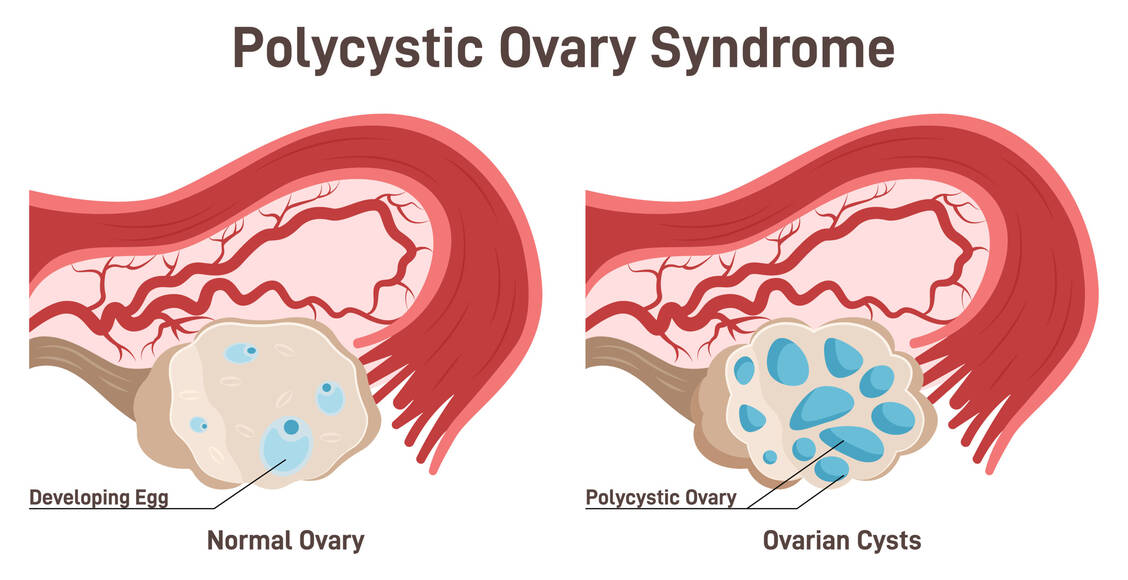Seit 2023 gibt es eine internationale Leitlinie zur Diagnostik und Behandlung des Syndroms. Kürzlich folgte die nationale S2k-Leitlinie – die erste zum PCO-Syndrom überhaupt (AWMF-Registernummer 089 - 004). Federführend an der Erstellung beteiligt war die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie (DGE).
»PCOS bleibt häufig unerkannt. Neben Zyklusstörungen, erhöhten männlichen Hormonen und unerfülltem Kinderwunsch steigt bei betroffenen Frauen auch das Risiko für weitere Erkrankungen: Typ-2-Diabetes, Schwangerschaftsdiabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettleber sowie psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen. Daher ist eine frühe Diagnose entscheidend«, sagt Professor Dr. Susanne Reger-Tan, Direktorin der Klinik für Diabetologie und Endokrinologie am Herz- und Diabetes-Zentrum NRW und Mitkoordinatorin der Leitlinie, in einer Pressemitteilung der DGE.