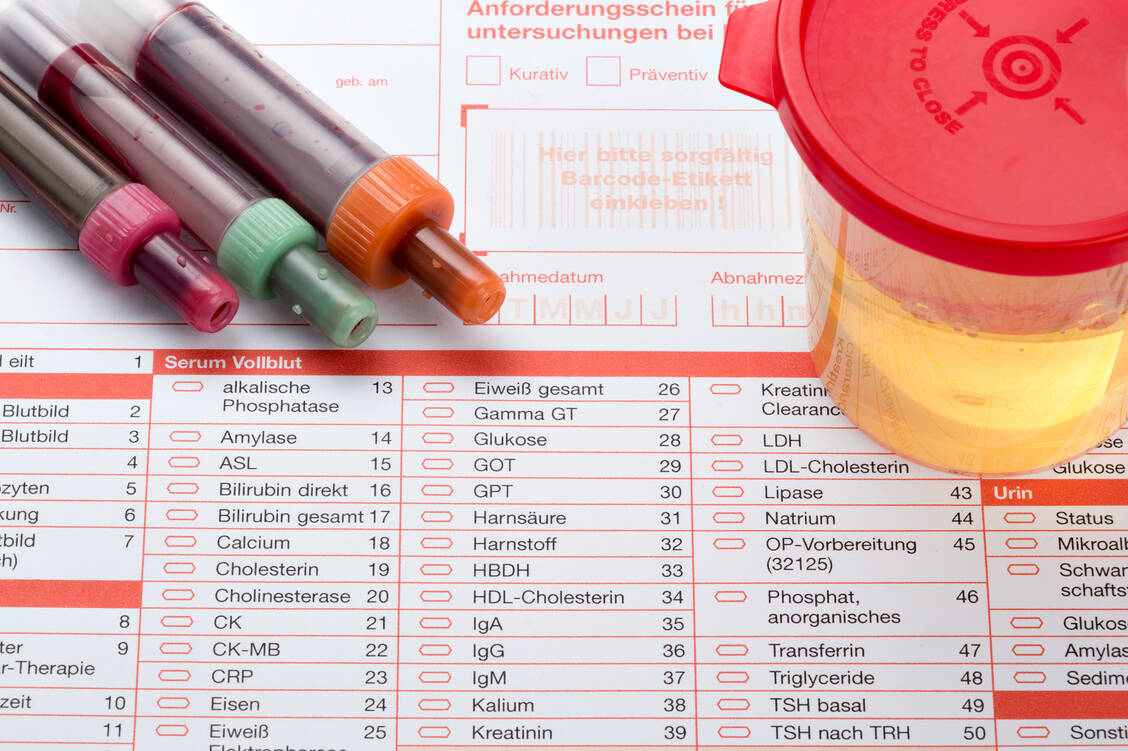Das klinische Bild des Cushing-Syndroms ist sehr heterogen und geprägt von den vielfältigen langfristigen Effekten der Glucocorticoide auf Organe und Gewebe. Symptome und Komorbiditäten sind unter anderem Dehnungsstreifen der Haut, Vollmondgesicht, Stammfettsucht und Atrophie der Muskulatur an Armen und Beinen, allgemeine Schwäche, Osteoporose, Glucoseintoleranz und metabolisches Syndrom, arterielle Hypertonie, Wundheilungsstörungen, verstärkte Blutungsneigung und thromboembolische Komplikationen. Ebenso können die Infektanfälligkeit steigen oder neuropsychiatrische Störungen wie Depressionen und Angst auftreten. Die Sterblichkeit ist vor allem aufgrund der Herz-Kreislauf-Komplikationen deutlich erhöht. Haupttherapieziel ist daher die Normalisierung des Cortisolspiegels, unter anderem durch chirurgische Entfernung des Hypophysen-Tumors, bilaterale Adrenalektomie oder Medikamente wie Osilodrostat oder das ältere Metyrapon (Metopiron®), die die Steroidsynthese unterdrücken.