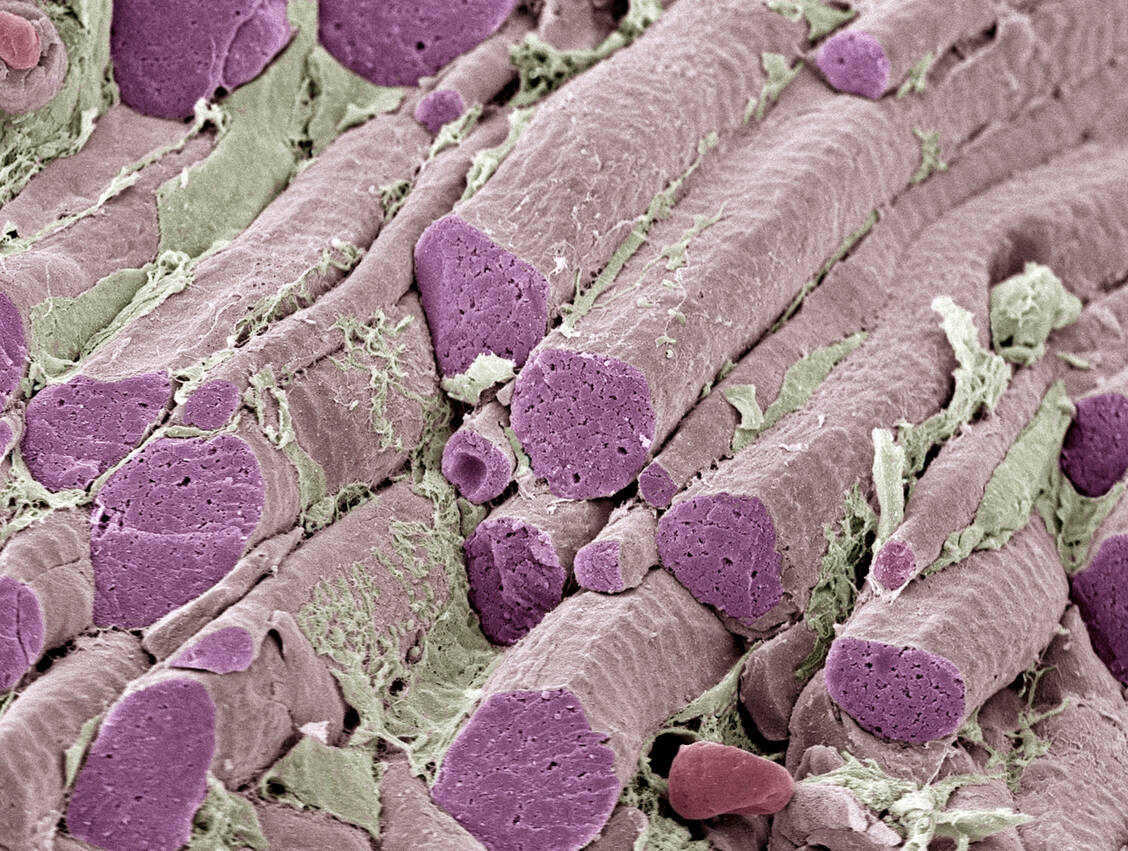Vamorolon bringt bei der Behandlung der Duchenne-Muskelatrophie (DMD) einen Fortschritt und kann damit vorläufig als Schrittinnovation bezeichnet werden. Es ist das erste in der EU uneingeschränkt zugelassene Arzneimittel für Patienten mit DMD. Hinzu kommt ein neuartiger Wirkmechanismus.
Vamorolon bindet zwar an denselben Rezeptor wie Glucocorticoide, dessen nachgeschaltete Aktivität ist aber offensichtlich modifiziert. Zudem sei der Arzneistoff laut Hersteller kein Substrat für 11-β-Hydroxysteroid-Dehydrogenasen, was für die lokale Erhöhung im Gewebe und für dortige Corticosteroid-assoziierte Toxizität aber notwendig wäre. Vamorolon wird daher auch als dissoziativer Entzündungshemmer bezeichnet. Das heißt, er soll die Wirksamkeit von den Nebenwirkungen abkoppeln. Er könnte daher eine Alternative zu Glucucorticoiden bei DMD darstellen.
Was in der Theorie ausgezeichnet klingt, zeigt sich in der Praxis aber leider nicht ganz. Zum einen war Vamorolon in der Zulassungsstudie zwar Placebo überlegen, Prednison aber nicht. Tendenziell war es sogar etwas schwächer wirksam als das bekannte Glucocorticoid. Und die Nebenwirkungen? Zu den am häufigsten gemeldeten unerwünschten Ereignissen zählte auch unter Vamorolon cushingoides Aussehen. Was andererseits aber wieder für Vamorolon als andersartiges Glucocortocoid spricht, sind Ergebnisse, die zeigen, dass der Wirkstoff im Gegensatz zu Corticoiden das Wachstum nicht einschränkt und auch keine negativen Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel hat. Weitere Daten zu dem Wirkstoff gilt es abzuwarten, um dann gegebenenfalls eine neue Einstufung vorzunehmen. Interessant wäre zudem, ob der Arzneistoff als Alternative zu Glucocorticoiden auch in anderen Indikationen funktioniert.
Sven Siebenand, Chefredakteur