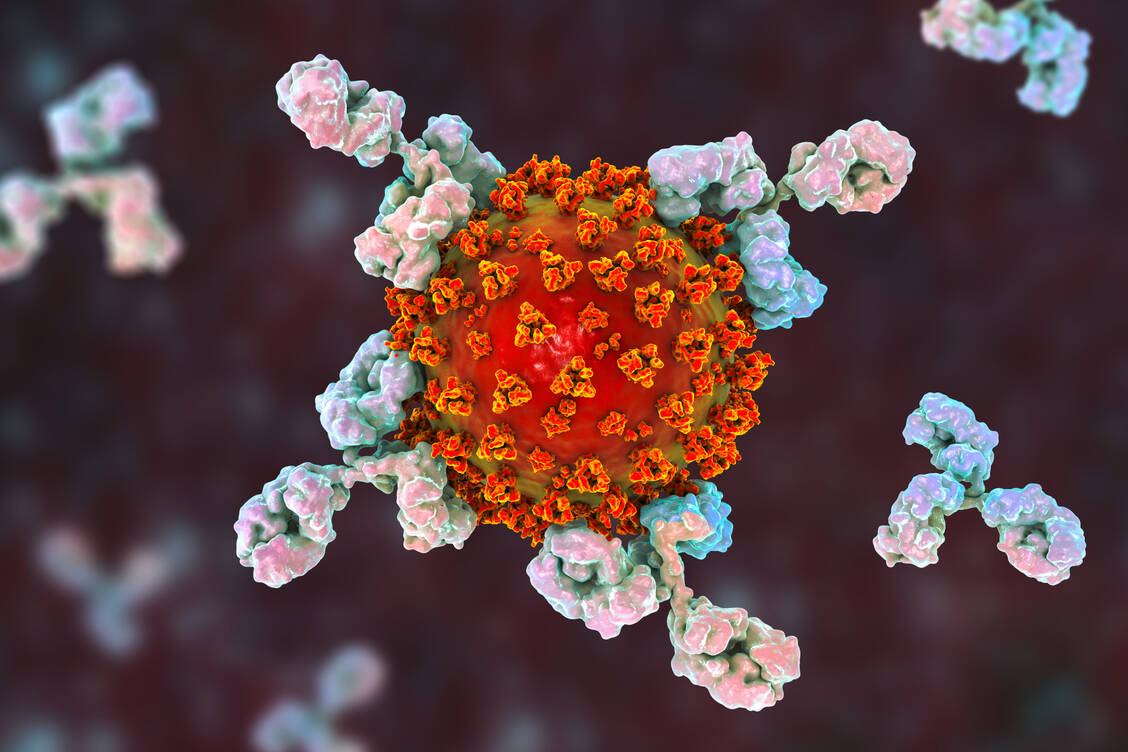Sipavibart ist der erste in der EU zugelassene monoklonale Antikörper mit der Endung -bart. Das hat an sich aber keinen Innovationswert. Wirkmechanismus und Einsatzgebiet von Sipavibart sind nichts Neues. Ein Statement der Emergency Task Force (ETF) der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA vom Dezember 2024 ist hilfreich, um zu begründen, weshalb Sipavibart als Analogpräparat einzuordnen ist. Dort heißt es zunächst, dass keiner der älteren Anti-SARS-CoV-2-Antikörper ausreichend Neutralisierungskapazität gegen neue Virusvarianten besitzt und deren Verwendung vermieden werden sollte, da es unwahrscheinlich ist, dass sie einen klinischen Nutzen bringen. Sipavibart habe breitere neutralisierende Wirkung gegen SARS-CoV-2-Varianten gezeigt, darunter XBB.1.5, XBB.1.16, XBB.2.3 und BA.2.86. Allerdings sei auf der Grundlage von In-vitro-Daten zu konstatieren, dass der Antikörper keine antivirale Aktivität gegen SARS-CoV-2-Varianten mit F456L-Mutation besitzt.
Die meisten derzeit kursierenden Varianten tragen diese Mutation. Die ETF betont, dass Sipavibart nicht verwendet werden sollte, wenn F456L-Varianten vorherrschend im Umlauf sind. In diesem Fall sei die Impfung nach wie vor die beste Option zur Vorbeugung einer Infektion, auch bei immungeschwächten Patienten.
Sven Siebenand, Chefredakteur