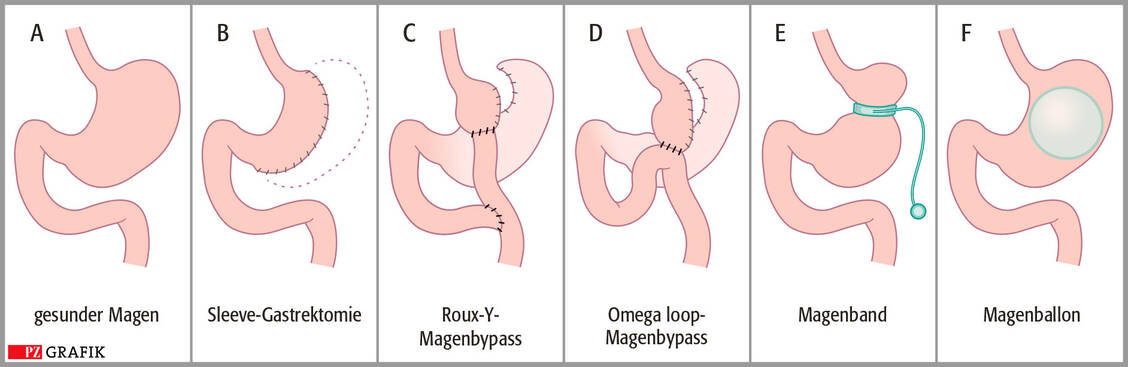Die Adipozyten sezernieren eine Vielzahl proinflammatorischer Adipokine, die chronische Entzündungsreaktionen hervorrufen und unterhalten (4). Durch erhöhte Plasma-Lipidspiegel wie vor allem freie Fettsäuren werden diese chronisch-entzündlichen Prozesse noch begünstigt. Die Entwicklung einer Insulinresistenz wird forciert.
Gemäß Studien der Internationalen Agentur für Krebsforschung (International Agency for Research on Cancer, IARC) steigt die Gefahr der Entstehung von Tumoren wie Brust-, Dick- und Enddarm-, Bauchspeicheldrüsen-, Magen-, Eierstock-, Speiseröhren-, Nieren-, Gallenblasen- oder Schilddrüsenkrebs (5). Allein das Risiko, an einem Ösophagusadenokarzinom zu erkranken, ist im Vergleich zu Normalgewichtigen um das 2,7-Fache erhöht.